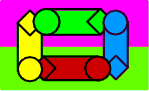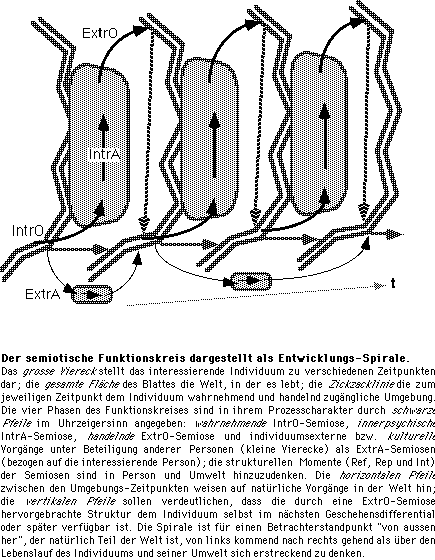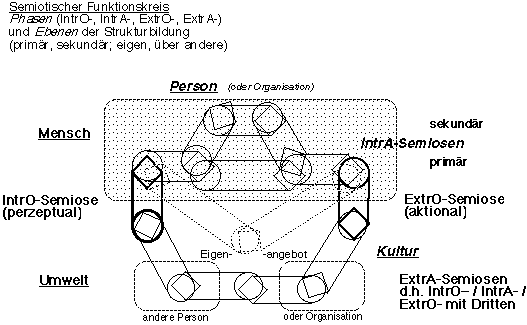|
Alfred
Lang
|
University
of Bern, Switzerland
|
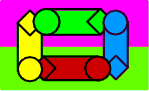
|
|
Edited
Book Chapter 1998
|
Das
Semion als Baustein und Bindekraft --
Zeit
aus semiosischen Strukturen und
Prozessen1
|
1998.01
|
|
@SemEcoPro @Time @GenSem @PhiSci
|
|
122
/ 148KB + 4 figs.
Last
revised 98.10.24
|
|
Pp. 73-116 in:
Ernest W.B. Hess-Lüttich & Brigitte Schlieben-Lange
(Hrsg., 1998) Signs & Time -- Zeit & Zeichen.
Kodikas / Code Supplement 24. Tübingen, Narr.
|
©
1998 by Alfred Lang
|
|
info@langpapers.org
|
|
Scientific
and educational use permitted
|
|
Home
||
|
Inhalt
- Einleitung
- 1.
Semiotische Ökologie
- 1.1. Die Welt als evolutiver oder
generativer Dialog
- 1.2. Weder objektives noch
subjektives Sein, sondern semiotives Werden
- 1.3. "Büro 2b", ein Beispiel
vom Wohnen
- 1.4. Genesereihen: Existenz und
Erscheinungswandel
- 1.5. Bioevolution als
Modell
- 1.6. Individualgenese und
Person-Kultur-Wandel
- 1.7. Struktur und Prozess im
ökologischen Funktionskreis
- 2.
Elementar-Semiotik
- 2.1. Semiose als Produktion oder
Strukturbildung
- 2.2. Semiotischer Funktionskreis:
ExtrO-, IntrO-, IntrA-Semiose
- 2.3. Semiotischer Funktionskreis
unter Einbezug der Kultur: ExtrA-Semiose
- 2.4. Das Semion als Basis der
logischen und strukturellen Ordnung der Semiose
- 3.
Semiosen als Zeitmacher
- 3.1. Eigene und affine
Zeit
- 3.2. Die Multiple innere Uhr als
semiotive Synthese
- 3.3. Hörphänomene:
dimensionale Vielfalt aus linearem Schwingen
- 3.4. Eine
semiotiv-ökologische Sicht der Zeit
- Eine
Art Zusammenfassung
- A Kind
of Summary
Hier soll eine besondere Form der Semiotik
in Grundzügen dargestellt und auf Fragen der Zeitkonstitution
und -analyse bezogen werden. Durch Betonung des generativen vor dem
interpretativen Aspekt von Zeichenprozessen (Semiose)
will sie das triadisch-semiotische Denken von Charles Peirce
praktikabler machen. Durch Einbezug des konservierenden und
generalisierenden Potentials von Zeichenstrukturen
(Semionen) erstrebt sie eine allgemeine Konzeption von
vermittelter Verursachung oder
Bedingungs-Wirkungs-Zusammenhängen, welche allen Erscheinungen
von Entwicklung gerecht werden kann. Diese Semiotik dient
insbesondere der Beschreibung des Werdens, des Wandels und des
Vergehens von:
* organischen oder organismischen
Systemen in ihrem Werden im Austausch mit ihrer Umwelt
(Phylogenese, Bioevolution).
* lernenden individuellen Organismen in
ihrem erfahrungsbildenden Lebenslauf in ihrer Welt, beim Menschen
also Personen in der Kultur (Ontogenese,
Individualevolution)
* sozialen Systemen oder Gruppen aller
Art in ihrem Werden zusammen mit ihrem Milieu, beim Menschen also
von Kulturen und ihren Differenzierungen (Kulturwandel,
Kulturevolution).
Entwicklung oder Evolution heisst hier
allemal jene systematische, zugleich divergierende und
konvergierende, dh geregelte und dennoch ungewisse Veränderung
von Systemen in ihren Rahmensystemen, die sich in der Rückschau
als historisch einmalig erweist und in die Zukunft offen ist.
Evolution ist im Unterschied zur physikalischen Zeit genuin zeitlich;
denn sie "kristallisiert" in jeder Gegenwart eine einzige von
vielen möglichen Zukünften jedes konkreten Systems
in nur eine, seine wirkliche Vergangenheit (vgl. Lang 1997).
Auf den genannten drei Betrachtungsebenen lassen sich bei aller
manifesten Verschiedenheit überraschende strukturelle
Gemeinsamkeiten zeigen. Und wenn die Semiotik unter anderem ein
allgemeines Verfahren zur vergleichenden Betrachtung von
Wissenschaften sein soll, dann muss sie sich genau beim Unternehmen
bewähren, Gemeinsamkeiten von Systemen in Entwicklung
herauszuschürfen. In der Tat hoffe ich,
* einen allgemeinen Semiosebegriff
in Prozess-Perspektive
* einen entsprechenden Strukturbegriff
(das Semion) in Zustands-Perspektive aufzuzeigen
* und dann deutlich zu machen, dass in
deren gemeinsamen Perspektive, der Verschränkung der Prozess-
und der Struktursicht, die Konstitution von Evolution und von Zeit
angelegt ist.
(I) Im ersten Teil werde ich die
Grundzüge der semiotischen Ökologie vom Inhalt her
darstellen. Der Leitgedanke ist der ökologische Funktionskreis,
nämlich die semiosische2
Verkettung von konkreten Lebewesen und ähnlichen Systemen mit
ihrer Umwelt in ihrem beidseitigen Wandel.
(II) Im zweiten Teil werde ich meine
Konzeption der Elementar-Semiose, den Begriff des Semion und
deren Verschränkung skizzieren. Dabei nehme ich auf Peirce bezug
und gebe ihm eine, bei ihm zwar angelegte, aber im allgemeinen wenig
geläufige Deutung, welche den generativen Charakter der Semiose
betont.
(III) Im dritten Teil spezifiziere ich die
gewonnenen Einsichten auf Fragen der Zeitkonstitution und
-analyse und suche so anhand eines von vielen möglichen
Beispielen die Fruchtbarkeit dieser generativ-semiotischen Denkweise
im ökologischen Funktionskreis aufzuzeigen. Wir sagen
gewöhnlich, Entwicklung finde in der Zeit statt, und müssen
damit Zeit in einer bestimmten Weise voraussetzen. Die These, jede
Entwicklung mache ihre eigene Zeit, findet jedoch zunehmend
Unterstützung. Lässt sich diese Vorstellung semiotisch
konkretisieren? Kann dies zu einem gründlicheren
Verständnis von Zeit führen?
Der vorliegende Text zeigt eine etwas
"grosszügige" Abduktion und dient der Einführung in
eine neuartige Denkweise. Deduktive und induktive Momente kann ich
nur fragmentarisch nachzeichnen, eher in illustrativer als in
demonstrativer Absicht (vgl. auch Lang 1992b und 1993a, b und c).
Es ist unvermeidlich, im Folgenden
verschiedentlich vertraute Unterscheidungen zu unterlaufen. Damit
gehe ich nicht nur Risiken der Ablehnung ein, sondern werde
möglicherweise sogar Empörung wecken. Ich möchte daher
die Leser bitten, mindestens solange in einem Als-Ob auszuharren, bis
die Konturen klarer werden. Die mutmassliche Tragweite meiner
Abduktion möchte ich vorab durch einige Thesen andeuten, welche
den Lesern vor einem zu engen Verständnis bewahren mögen.
Es geht hier um:
[1] Ablösung von
gewohnten metaphyischen Setzungen darüber, was ist oder sein
soll, durch die Annahme, unser Universum sei durchgängig
evolutiv.
[2] Auflösung aller
abendländischen Dualismen, insbesondere der
Stoff-Geist-Opposition, in einer umfassenden
Kontinuitätsannahme. Auch die Prinzipen, welche den Gang wie
die Ordnung der Welt bestimmen, und nicht nur diese Ordnung
selbst, seien als evolutive Emergenzen zu verstehen.
[3] Ersatz der epistemologischen
Antinomien, insbesondere der Subjekt-Objekt-Spaltung durch die
Überzeugung, Menschen seien voll und ganz ein "normaler" Teil
dieser Welt und "Erkennen" erschöpfe sich im Generieren von
Strukturen in und zwischen Organismen, die auf andere Strukturen
in und zwischen Organismen bezugnehmen. Das impliziert, dass es im
Werden der Welt keine vor allen anderen ausgezeichnete Stellen
gibt.
[4] Übergang von einer
interpretativen zu einer generativen Semiotik von vermittelten
Bedingungs-Wirkungs-Zusammenhängen. Obwohl schon Peirce
postuliert hat, "kein Zeichen kann als solches wirken, ausser
insofern es in ein anderes übersetzt wird" (1904, CP
8.225n10) hat sich die Semiotik bisher nicht mit der Produktion
von Zeichen befasst.
Inhalt
1.
Semiotische Ökologie
Semiotik kann abstrakt als eine
allgemeine Logik des Werdens von fast allem verstanden werden.
Semiose beschreibt Denken oder Interaktion von Symbolen im engeren
Sinn ebenso wie die Bildung von konkreten Strukturen wie grossen
Molekülen, Lebewesen oder deren Produkte überhaupt.
Abgelöst von Inhalten ist Semiose als eine triadische Relation
freilich unterbestimmt. Zusammen mit Inhalten ist sie eine
dynamische Theorie des Werdens und Wandels insbesondere von
Strukturen, welche aus ihrem stofflich-energetischen Bestand
allein nicht ausreichend bestimmt sind.
Zuerst möchte ich deshalb eine
summarische inhaltliche Darstellung meines primären
Entwicklungs- und Anwendungsfeldes dieser Semiotik geben. Es sind
dies ökologische Systeme, dh Organismen, als Individuen,
als deren Bestandteile oder als Gruppen, im Informationsaustausch mit
ihrer jeweiligen Umwelt einschliesslich der kulturellen Umwelten bei
Menschen.
1.1. Die Welt als evolutiver
oder generativer Dialog
Ich halte es für sinnvoll, grosse Teile
der Welt als etwas dialogisch Evoluierendes zu verstehen.
Jedenfalls mindestens jene Teile, die wir mit Leben in
Verbindung bringen, und jene, die darauf gründen wie die
Kultur der Menschen. Evolution beruht auf dialogischer
Generation: Neues wird unter teilweiser Auflösung von Altem aus
Interaktionen zwischen Bestehendem.
Die Idee besagt einfach, dass alles was ist
-- insofern und wie wir es bemerken können, natürlich --
geworden ist aufgrund von anderem was geworden ist. Und dass es
seinerseits anderes hervorbringt in endlosen Ketten. Besser in
endlosen Netzen. Denn es gibt bei diesen Hervorbringungen
Verzweigungen und Rekursionen, verschiedenartig Neues und zugleich
hohe Kohärenz und Systematik. Diese Idee ist zu
präzisieren.
Ein dialogisch-evolutives Weltbild
ist in den meisten asiatischen und vielen anderen Kulturen recht
selbstverständlich. Im Abendland hat es einen schweren Stand,
weil hier früh die Idee aufgekommen ist, man müsse
einen Letztbeweger oder einen Letztgrund aller Dinge annehmen,
der die Ordnung des Ganzen sichere. Abendländische
Kulturgeschichte kann gelesen werden als gewaltsame und trickreiche
Durchsetzung des quasi-linearen Determinationsdenkens gegen
immer wieder auftretende Vorschläge zum offenen
Evolutivdenken.
So haben hier Konzepte wie der eine
Gott, das allgültige Naturgesetz, die absolute Vernunft, der
Weltgeist, "das" Gute und "das" Schöne, das individuelle Subjekt
und viele verwandte Ideen eine merkwürdige, alles
überschwemmende Rolle bekommen und beherrschen unser Leben
selbst dann noch, wenn wir ihre Problematik längst durchschauen.
Mit ihrer Grundform: dieses ist oder tut jenes, spiegeln und
tragen die indo-europäischen Sprachen das Determinations- und
Festlegungsdenken.
Als Name für den Komplex verwende ich
gewöhnlich den Ausdruck "Kartesianismus". (Das ihm damit
angetane Stück Unrecht möge M le Chevalier des Cartes de
Perron gegen die gewonnene Ehre aufrechnen; vgl. Davidenko 1988.) Die
Dualismen von Subjekt und Objekt, von Geist und Materie,
einschliesslich der Pseudo-Monismen des sog. Materialismus und des
Idealismus, sind zentrale Manifestationen davon. Ich halte die
triadische Semiotik im Ausgang von Peirce für die
meistversprechende Perspektive zur allmählichen Ablösung
dieser Mentalität.
Der Kern der Gegenidee wurde nach einigen
tastenden Vorläufern wohl erstmals in erstaunlich umfassender
und kohärenter Weise formuliert durch Johann Gottfried
Herder. Um 1770 erstmals in aller Klarheit in der Schrift
über den Ursprung der Sprache und dann in den
verschiedenen Arbeiten zur Philosophie der Geschichte der Bildung
der Menschheit. Herder empfiehlt, natürlich in der Sprache
seiner Zeit, wir könnten ohne eine besondere Instanz auskommen,
weder Divinität noch Natur, die uns die Sprache und andere
kulturelle Errungenschaften gegeben habe. Die Menschen hätten
solches in evolutiven Dialogen allmählich selber hervorgebracht
und alles weitere würde stets darauf weiterbauen. "Schon als
Thier hat der Mensch Sprache" lautet der
revolutionär-enigmatische Anfangssatz der Sprachschrift. Damit
ist insbesondere auch der Weg zu einer natürlichen
Erklärung der Diversität der Kulturen und der Geschichte
einer jeder von ihnen geöffnet. Herders eigenes Denken beruht
natürlich evolutiv-dialogisch auf den Impulsen und Denkfehlern
der Aufklärer und den tastenden Versuchen der
Gegenaufklärer und scheint in hohem Masse durch das in den
alttestamentlichen Schriften dargestellte evolutiv-dialogische
Geschehen zwischen dem einen Gott und seinem Volk inspiriert worden
zu sein. Denn im Werden dieser Schriften konstituieren einander
sowohl Gott wie das Volk gegenseitig und gewinnen schrittweise ihren
Charakter (vgl. auch Miles 1996).
Herders Zeit war aber offenbar nicht reif
für eine so kühne Idee, jenes bis heute herrschende
Weltbild abzulösen, das Plato im Timäus initiiert hat
(Meier-Abich 1994). Man hat einen hartnäckigen Rivalenkampf
zwischen Naturalismus und Historismus vorgezogen, der bis
heute anhält und uns belastet. Naturalismus und Historismus
erklären sich zunächst nur je für einen Teil der Welt
zuständig, entweder die Natur oder die Gesellschaft der
Menschen; doch versuchen die einen wie die andern, ihr
Erklärungsmodell auszudehnen und propagieren den
physikalistischen bzw.den geistigen oder linguistischen
Reduktionismus. Beide vertreten im Prinzip das Vorherrschen von
Gesetzmässigkeit in der Welt, müssen aber daran angesichts
von unleugbaren Unregelmässigkeiten Abstriche machen. Die
eingeführten Hilfskonstruktionen, im einen Fall der "Zufall", im
andern der menschliche "Wille" können freilich weder einzeln
noch in Kombination überzeugen; dennoch scheinen diese Konzepte
weitherum zur Gewohnheit des Denkens geworden zu sein. Das Kantische
transzendentale Subjekt mit seiner ewigen Vernunft-Ausstaffierung hat
sich um 1800 -- mit oder trotz der revolutionär gewonnenen
Freiheiten -- durchgesetzt und beherrscht in abgewandelten Formen das
Leben des 19. und 20. Jh. in den subjektiv-individuellen oder den
objektiv-allgemeinen Varianten des sogenannten Geistes
und der "objektiven" Materie und ihrer
mathematischen Darstellung.3
1.2. Weder objektives noch
subjektives Sein, sondern semiotives Werden
Es scheint, dass die abendländische
Zivilisation bis heute von diesen Geistern besessen ist. Wir gaukeln
uns eine uns verfügbare Natur vor, obwohl wir von ihr ein
fragiles Teil sind. Und wir versprechen uns wechselseitig, vermutlich
je nach dem jeweiligen partikulären Nutzen,
Handlungsfreiheit oder Gesetzesbestimmtheit, beides
überformt mit ein bisschen Zufall oder Willkür.
Das wird uns früher oder später
als Individuen und Gemeinschaften zerreissen. Aber wir halten den
Widerspruch lange aus; er bietet eben auch Vorteile: mal
ermächtigt uns unsere Subjektivität zu jeder
Freizügigkeit für den oft schwer einforderbaren Preis von
Verantwortlichkeit als Subjekte; mal entlassen uns die
Sachzwänge aus jeder Verantwortlichkeit, weil wir den ewigen
Gesetzen der objektiven Welt ja nicht entgehen können. Im
Pendeln zwischen den beiden Haltungen, im Aufteilen ihrer Prinzipien
auf verschiedene Fakultäten, im Verwedeln des Widerspruchs, sind
wir Meister geworden. Und wir Abendländer "beglücken" damit
den Erdkreis.
Ich halte es für wichtig, diesen
Zusammenhang zwischen Weltbild und unserem Verständnis der
menschlichen Kondition herzustellen, auch wenn ich meine Auffassung
davon hier nur andeuten kann (vgl. auch Lang 1994 / im Druck). Auch
die Trennung der menschlichen Belange in Sachzwänge einerseits
und Normen und Freiheiten anderseits, maW der Versuch, die ethischen
Prinzipien unabhängig von den Sachzusammenhängen zu
bestimmen oder umgekehrt, muss als eine Folge der kartesianischen
Dualismen gesehen werden.
Dem allem ist etwas entgegenzusetzen. Auch
Charles Sanders Peirce hat dies seit 1866 getan und hat
allerdings damit bis weit ins 20 Jh. hinein kaum Interesse gefunden.
Er wurde nicht nur nicht verstanden sondern sogar am Lehren und
Publizieren gehindert; auch noch gegen Ende des 20. Jh. wird er nicht
selten nach dem alten Schema umgedeutet. Selbstverständlich
verfügt niemand über die gültige Interpretation von
Peirce. Das wäre eigentlich auch das letzte, was er hätte
wünschen wollen. Was er aber zweifellos anzielte, ist die
Ablösung der Einteilung der Welt in eine objektive und eine
subjektive.
Eine seiner revolutionären Einsichten
betrifft die Natur der Gedanken oder Repräsentationen.
Thoughts, sagt er, sind nicht in uns;
vielmehr sind wir in Gedanken (CP 5.289n=EP1:42). Für
"Gedanken" kann man auch "Zeichen" setzen. Ja, Menschen sind
aus Zeichen und in Zeichen, sind selber zeichenhaft.
Gedanken sind in ihnen und zwischen ihnen, um sie herum. Wie
können wir über die Gedanken in uns erfahren? Nur dadurch,
dass wir sie in Gedanken ausser uns umsetzen. Anders sind sie nicht
nur nicht zugänglich, sondern eigentlich auch nicht wirksam; sie
können in uns leichter mit unseren anderen Gedanken
zusammenwirken als ausser uns. So scharf und eindeutig abgegrenzt vom
und entgegengesetzt zum Rest der Welt sind wir jedoch nicht, wie wir
uns einreden.
Ersetzen wir also die sogenannten
subjektiven Welten und die objektive Welt, ob materiell oder geistig,
durch die semiotive Welt: die Welt, die in Zeichen existiert
und durch Zeichenprozesse wird. Das ist auszuführen.
Vielleicht ist es gut, wenn ich an dieser
Stelle anmerke, dass ich den Ausdruck "Zeichen" so weit wie
möglich meide, dh nur alltagssprachlich und in Zitat oder
Paraphrase einsetze. Wo ich den Bezug markieren möchte, weiche
ich auf Ausdrücke wie Zeichenprozess, Zeichencharakter
oder zeichenhaft aus. Sensibilisieren möchte ich auch
für die ständig zu beobachtenden Objektivierungen
einerseits der Zeichenträger, und warnen vor der
merkwürdigen Subjektivierung dessen, was Zeichen bedeuten
sollen. Zeichenhaft ist alles, was Wirkungen vermitteln kann. Der
Zeichenprozess wird am besten als eine allgemeine Verursachungs-
oder Bedingungs-Wirkungs-Konzeption verstanden.
Mit "Zeichencharakter" meine ich eher eine
Suchvorstellung, eine Heuristik: wenn Du feststellst, dass A eine
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung von C ist, wenn die
Wirkung C der Bedingung A inkommensurabel ist, dann suche doch eine
vermittelnde Instanz B, welche mit A zusammen C herbeiführen
kann. Die kannst Du dann "zeichenhaft" nennen, egal wo und in welchen
Formen und wie vage immer Du sie findest.
Wenn Du mit allen erdenklichen
physiko-chemischen Zusammenhangskenntnissen Dir nicht zusammenreimen
kannst, dass ein rotes Licht am Strassenrand fast alle Menschen dazu
bringen kann ihre tonnenschweren Blechkabinen anzuhalten, dann suche
nach einem vermittelnden Dritten. In diesem Fall wirst Du auf
zeichenhafte Strukturen im Kopf der Menschen schliessen müssen.
Denn der Wirkungszusammenhang funktioniert nicht, wenn so etwas nie
dort hineingelangt ist oder wenn es dort durch andere Strukturen
unwirksam gemacht, verdrängt oder ersetzt worden ist.
1.3. "Büro 2b", ein Beispiel vom
Wohnen
Diese etwas allgemeinen Ausführungen
waren nötig, um den Horizont abzustecken. Jetzt gehe ich aber
ins konkrete semiotive Geschehen. Als Referenz diene ein Beispiel aus
unserem Forschungsbereich: Menschen mit ihren Dingen in ihren
Räumen. Gemeint ist die semiotive Tätigkeit des
Wohnens.
In der Diplomarbeit von Stefan Markwalder
(1993) haben wir den beiden Partnern zweier Lebensgemeinschaft je
einen Pager und ein Diktiergerät gegeben. Der Pager gab zwei
Wochen lang zu zufälligen Zeitpunkten im Durchschnitt nach 25
Minuten ein Zeichen, frühestens nach 10, spätestens nach 50
Minuten. Die Person sollte dann ins Diktiergerät sprechen, was
sie gerade tat: wann und wo, mit wem, mit was, in welchem
Zusammenhang. Unsere Informanten taten das eifrig und gewissenhaft.
Natürlich konnten sie den Pager, zB bei Besuch, ausschalten,
taten es aber praktisch nur in der Nacht und wenn sie ausser Haus
waren.
Aus den konkreten Momentaufnahmen konnte,
ergänzt durch Photoaufnahmen der Lokalitäten durch die
handelnden Personen selbst und ein Gespräch mit ihnen zur
Hintergrundsbildung und Vorgeschichtenklärung, eine
überraschend reichhaltige Rekonstruktion weiter Teile des
Wohngeschehens gebildet werden. (Für weitere Forschung in diesem
Paradigma sind Forschungsberichte verfügbar und eine
grössere Publikation in Vorbereitung.)
Ich greife ein Beispiel heraus. Hans und
Silvia, Lokomotivführer und in Garten und Sozialhilfe engagierte
Hausfrau, bewohnen nach dem Weggang der Kinder weiter ihr kleines
Einfamilienhaus. Im engen Aufgang zum zweiten Stockwerk schimmelte es
in einem Schrank. Hans reisst ihn heraus und bringt an seiner Stelle
eine Arbeitsplatte an. Dort fängt er an schriftliche Arbeiten zu
machen. Und es behagt ihm so gut dort, dass er bald
Büchergestelle, Schubladen, Lampe etc. ergänzt und
schliesslich in die Dachschräge ein Oberlicht-Fenster einbaut.
Er verbringt nun viel Zeit dort. Silvia, die wie Hans ihre eigenen
Winkel im Haus hat, ändert allmählich ebenfalls die
raum-zeitliche Verteilung ihrer eigenen Aktivitäten. Sie sitzt
dann gelegentlich auf der Treppe und der Ort wird ein beliebter Platz
zB für Konfliktlösungsgespräche. Aber auch das
Zusammen- und das Nebeneinandersein der beiden im Wohn- und im
Esszimmer ändert im Gefolge des Umbaus Dauer und
Charakter.
Das ist ein Beispiel einer kleinen
generativ-dialogischen Evolution dieses Wohnsystems. Sie
lässt sich in Grundzügen vielleicht so beschreiben. Ein
Vorgang fremder Art (Schimmelpilz) veranlasst eine Handlung von Hans.
Deren Ergebnis, die Arbeitsplatte, führt zu neuen und durchaus
unvorgesehenen Handlungsgewohnheiten, die ihrerseits Handlungen zu
Verbesserung der diesbezüglichen Handlungsbedingungen
auslösen und natürlich auch ein ganzes Spektrum von
begleitenden Stimmungen und Emotionen bei Hans bedingen. Gleichzeitig
setzt aufgrund dieser allmählich erneuerten raum-zeitlichen
Handlungsmuster in den neuen Handlungssituationen auch bei Silvia ein
entsprechender Verhaltens- und Gewohnheitenwandel ein. Dessen Wirkung
ist nicht nur in weiten Teile des Hauses beobachtbar, sondern
beeinflusst auch die Art der Beziehungspflege zwischen den beiden und
trägt mutmasslich ihrerseits ihr Teil zu weiteren
Gewohnheitenänderungen bei Hans bei.
Die vielfältigen Weiterungen, welche
die Einrichtung von Büro 2b noch haben wird (die Bezeichnung ist
vom Paar selbst), sind in ihren Verästelungen nicht abzusehen.
Doch kennen wir solches aus anderen Beispielen und wohl auch aus dem
eigenen Leben, finden es jedoch kaum in den Theorien menschlichen
Werdens.
1.4. Genesereihen: Existenz und
Erscheinungswandel
Ich denke aber, wir sollten solche
Vorgänge aus ihrer Bedingtheit heraus und im Zusammenhang ihrer
möglichen Wirkungen darzustellen versuchen. Etwas im Rahmen
seiner wirklichen Bedingungen und Wirkungsmöglichkeiten zu
beschreiben, heisst eigentlich auch schon, es zu verstehen oder zu
erklären. Die Psychologie hat dazu keine geeigneten Mittel
herausgebildet, weil sie die Handlungs- oder Entwicklungsbedingungen
langezeit entweder in abstrakten Dispositionen der einzelnen
Personen, in kollektiven Normen oder in willkürlich ausgesuchten
Stimuli der jeweiligen Situation bzw. in allgemeinen Stimulusklassen
gesucht hat. Heute ist zwar weitherum anerkannt, dass solche
verschiedenartigen Bedingungen ein System bilden, aber es sind bisher
keine durchführbaren Vorstellungen darüber entwickelt
worden, wie sie im konkreten Vorkommen zusammenwirken und wie jene
genannten nominalen Instanzen reale Wirkungen hervorbringen
können. Vermutlich deswegen, weil konkrete Systeme in ihrer
Zusammensetzung stets einmalig sind, die Wissenschaftler aber einen
allgemeinen Begiff von Systemen anstreben, die mithin eigentlich nur
nominale (dh im Kopf und in den Begriffen der Betrachter
residierende) Systeme sind. Das Verhältnis zwischen dem
Allgemeinen und dem Besonderen scheint nicht ausreichend geklärt
zu sein.
Entwicklungs- oder allgemein evolutive
Prozesse lassen sich in der Tat nicht allein durch allgemeine Gesetze
von der Art der Naturgesetze abdecken, weil ja die Bedingungen jeder
Phase erst in den vorausgehenden Phasen entstehen, eben auf der Basis
dessen, was vorher geworden ist, und also nicht von Anfang an oder
gar ausserzeitlich feststehen können. Die meisten antreffbaren
Erscheinungen in dieser Welt sind rein stofflich-energetisch gesehen
extrem unwahrscheinliche Verläufe und Hervorbringungen. Sie sind
nicht nur einmalig und dennoch systematisch, sondern auch
irreversibel und überdies nach vorne, in die Zukunft offen.
Es lassen sich denn auch in evolutiven
Systemen in keiner konkreten Weise systemübergreifende oder
-externe Ziele oder Sollzustände aufweisen, welche das Geschehen
eindeutig bestimmen oder regulieren könnten; noch können es
Willensakte oder andere biotische oder geistige Instanzen wirklich
systematisch steuern, welche unabhängig vom Systemgeschehen
selbst aufzuweisen sind. Andernfalls müssten wir das
Grundverständnis von Evolution aufgeben, nämlich dass sie
sich aus dem Zusammenwirken von unabhängigen Faktoren ergibt.
Auch unser bewusstes Erleben dieser Dinge steht in einem weitgehend
ungeklärten Verhältnis zum Geschehen selbst. Nicht nur ist
es höchst selektiv bezüglich der gesamten unabdingbaren
Momente eines Verlaufs; es ist auch höchst punktuell,
während die Organisation eines Geschehens, ob Wahrnehmung oder
Handlung, Vor- und Rückbezüge auf Früheres und auf
Mögliches bzw. Unmögliches einschliesst. Manche Indizien
weisen darauf hin, dass das Erleben, da viel langsamer als
psychomotorische Prozesse, in manchen Fällen das Geschehen nicht
steuern kann, weil es ihm nachfolgt, nachträglich reflektierend
oder rechtfertigend (vgl. zB Nisbett & Wilson 1977).
Dennoch handelt es sich um bei allem in der
Welt sich Orientieren oder Agieren -- hier also von Menschen mit
ihren Dingen in ihren Räumen -- um ein gerichtetes
Entwicklungsgeschehen in einem, besser, eines
ökologischen Systems. Es würde nämlich schon die
Beschreibung entstellen und das Verständnis des Prozesses
verunmöglichen, wollte man es etwa auf drei
Veränderungsreihen aufteilen, eine von Hans, eine von Silvia,
eine (oder gar mehrere) des Hauses und seiner Bestandteile und
Einrichtungen. Fokussiert man auf eine ausgewählte von ihnen, so
muss man zwingend die andern mitdenken, wie das natürlich in
guter psychologischer Praxis, leider aber nicht in der Theorie,
geschieht.
Uns interessiert ja, das Geschehen
wissenschaftlich auf Begriffe zu bringen und die Begriffe und ihr
Zusammenspiel so anzulegen, dass ein Typus generativ-dialogischer
Evolution abgedeckt und in concreto methodisch, begrifflich
wie empirisch, durchführbar wird. Kurt Lewin hat den Begriff
Genesereihen eingeführt für die Forderung, dass
Erscheinungen, deren Sosein (Merkmalsmuster) im Wandel
erklärt werden soll, auf einem Dasein (Existenz) beruhen
müssen, welches sich unter dem Wandel der Erscheinung
existentiell durchzieht. Nur aus ihrem Werden können
Erscheinungen begriffen werden; darauf beruht in den
Naturwissenschaften das ungeheure Potential von Verfahren wie zB von
Differentialgleichungen oder Simulationsmodellen. Ein Wandel ohne
zugrundeliegende durchgehende Existenz ist aber vielleicht kein
Werden, keine Transformation, sondern bloss eine Reihung von
Erscheinungen, möglicherweise bloss im Auge ihres
Betrachters.
Lewin (1922; vgl. Lang 1992a) hat in
überzeugender Weise dargelegt, dass die physiko-chemischen
Wissenschaften bezüglich der ihren Begriffen und Methoden
zugrundeliegenden Genesereihen völlig andere Existenzannahmen
machen als die Wissenschaften vom Leben. Zumindest die klassische
Physik macht Aussagen ausschliesslich über abgeschlossene
Systeme, aus denen heraus bzw. in die hinein, soweit die Gesetze
gelten, nichts Stofflich-Energetisches verloren gehen und nichts dazu
kommen kann. Natürlich lassen sich unter Realbedingungen
natürliche Systeme aus ihrer Umgebung nicht sicher abgrenzen; so
erklären die stofflich-energetischen Naturgesetze in der
Wirklichkeit nur, was geschehen kann; was wirklich geschieht, jedoch
nur insofern die Randbedingungen des Materiellen keine Rolle Spielen.
Kosmologie, Mineralogie, Geologie u.v.a.m. sind natürlich
historische Wissenschaften. Würden nun die Biologen
gleiche Existenzannahmen wie die nomothetischen Physiker und Chemiker
machen, so müssten sie von toten Organismen handeln, da lebende
Systeme gerade durch den essentiellen Austausch von Stoff und Energie
mit ihrer Umgebung charakterisiert sind, während sich etwas
von strukturellem Charakter während der ganzen Lebenszeit
von Organismen oder durch die Entwicklung der Arten hindurch als
durchgehend existent erweist.
Diese durchgängige Existenz beim Wandel
von Erscheinungen begriff Lewin als Genesereihen und stellte die
Aufgabe, ihren unterschiedlichen Charakter in den verschiedenen
Wissenschaften zu explizieren und zu vergleichen. Seine Leitfrage
war: welchen Charakter haben die psychologischen Erklärungen
zugrundeliegenden Genesereihen? Er konnte keine klare Antwort
finden und musste sich auf die Genesereihen beschränken, welche
die Physiker und die Biologen voraussetzen. So bleibt uns die
Aufgabe, die Idee der Genesereihe zur Fundierung eines allgemeineren
Erklärungsbegriff auszubauen und für andere als physische
und biotische Systeme fruchtbar zu machen.
Der Begriff der Genesereihe verlangt
nachdrücklich, Verursachungs- oder Bedingungskonzepte nicht
bloss auf der Ebene nominaler Denkschemata zu suchen, welche wir
über allgemeine Fälle in von uns klassifizierten
Vorgängstypen stülpen. Es reicht nicht zu sagen, das Milieu
spiele bei der Person- oder Intelligenzentwicklung eine Rolle; und
die Verwendung von aggregatstatistischen Angaben täuscht nur
darüber hinweg, welche Rolle denn nun welches Milieu bei welchen
Personen auf welche Weise wirklich spiele.
Gefordert ist vielmehr eine
Bedingungs-Wirkungs-Konzeption für evolutive Prozesse,
welche in konkreten Situationen hier und jetzt reale
Wirkungszusammenhänge aufzuklären vermag. Deren Natur kann
jedoch, wenn es um evolutive und semiotive Gebilde geht, nicht
sein: wenn A, dann B, wie bei den physiko-chemischen
Existentialreihen. Auch nicht unter nachklassischer Anreicherung:
wenn A, dann, unter Beachtung gewisser Zufallsfluktuationen,
B. Denn solches kann wohl, wie die Chaos-Theorie demonstriert,
allerhand geordnetes Verhalten von aus dem Gleichgewicht gebrachten
selbstregulativen Systemen nachvollziehbar machen. Es kann aber nicht
deren systematischen, akkumulativ-integrierenden Wandel klären,
den wir Entwicklung oder Evolution im allgemeinen nennen und der
darauf gründet, dass Veränderungen auch die Bedingungen von
Wandel verändern können. Was sich entwickelt, sind eben gar
nicht Stoff und Energie, sondern deren Formung: jene Gebilde oder
Strukturen, welche die so unwahrscheinlichen Anordnungen von Stoff
und Energie darstellen, wie sie in der Lebenswelt vorkommen und ihre
im Lauf der Zeit immer neuen Funktionsweisen bedingen. Wissenschaften
vom Leben und Kulturellen müssen von Strukturen und ihrem Wandel
aus Interaktion handeln.
Um den Tatsachen evolutiven Wandels gerecht
zu werden, braucht es in der Verursachungskonzeption ein reales
und uns prinzipiell zugängliches Drittes, wie wohl als
erster Charles Peirce in aller Klarheit gezeigt hat: wenn A und
B, dann C. Und dabei müssen A und B einerseits bestimmte
Bedingungen ihres Zueinanders, ihrer Interaktionsmöglichkeiten
erfüllen, damit es zu einem wirklich neuen C kommen kann, wie
die Idee der Entwicklung es prinzipiell verlangt. Sie müssen
anderseits voneinander unabhängig existieren und zusammentreffen
können. MaW, sie müssen unterschiedlich aber doch
miteinander verwandt sein und sie müssen miteinander
interagieren können. Überdies müssen A und B nicht nur
konkrete Gebilde sein, sondern eines von ihnen muss einen allgemeinen
Charakter haben, wenn es in wiederholten Interaktionen zu
ähnlichen Cs kommen soll, welche einmal eingeleitete
Genesereihen konsistent fortsetzen, wie es die Idee der Entwicklung
verlangt.
1.5. Bioevolution als
Modell
Das Zustandekommen von Bioevolution wird
durch die beiden Prinzipien der Variation und Selektion im
Wesentlichen geklärt. Man muss aber den Vorgang etwas
detaillierter auslegen. Variation beruht zunächst auf
"fehlerhafter" Replikation von Strukturen -- Stoff und Energie
können nicht "fehlerhaft" interagieren! --, wobei der "Fehler"
als nicht perfekte Replikation in der genetischen Reihung sich als
Schöpfungskraft erweist. Die Bedingung des Fehlers, freilich,
ist bereits ein minimales Moment jenes Dritten, welches die "lineare"
Reihung von notwendigen Schritten in einen Baum von Verzweigungen
verwandelt. Die Ausgangsstrukturen müssen in Interaktion mit
einem Andern, einem Dritten treten.
Aber Variation als solche bringt nichts
Beständiges hervor. Die so entstandenen neuen Strukturen
ihrerseits immer weiter zu replizieren, müsste je nach
Fehlerrate früher oder später zu unendlicher Vielheit
generierter Strukturen führen. Damit jene physiko-chemisch so
extrem unwahrscheinlichen und dennoch so erstaunlich metastabilen
Strukturen wie Organismen und ihre Teile und Produkte mehr als
unendliche Proliferation kausaler Linien sein können, ist
wiederum ein Bezug oder Dialog mit etwas Drittem nötig:
mit solchen Strukturen, welche die Variationsvielfalt dadurch
begrenzen, dass sie einigen aus der Vielfalt grössere, anderen
geringere Möglichkeiten weiterer Replikation einräumen:
auch Selektion ist also triadischen Charakters.
Bei Varation wie bei Selektion braucht es
jeweils zwei Strukturen im Wechelspiel in einem gemeinsamen
Milieu, die einander wechselweise in Prozessen vom Typus: wenn
A und B, dann C, hervorbringen, nämlich aus dem jeweiligen
Milieu herausbilden bzw. darin erhalten. Gesetze vom Typus: wenn
A, dann B, schaffen es nicht. Bei der Variation kennen wir
mutative und rekombinative Veränderungen des Genoms. Im
zweiten Fall treten die beiden haploiden Gensätze auf teils
zufällige Weise zum neuen Genom zusammen; im ersten ist ein
energetischer oder chemischer Zufallsfaktor eine minimale
Zweitbedingung. Bei der Selektion wird der individuelle
Organismus viele Male mit Umgebungsbedingungen von mancherlei
Art zusammentreffen, woraus er gesichert oder gestärkt
hervorgeht und wodurch seine Wahrscheinlichkeit, Nachkommen zu haben,
gesteigert, diejenige anderer Varianten jedoch vermindert wird.
Variation wie Selektion, sind entscheidend vom Ausmass der Passung
mit der konkreten Umgebung bestimmt, in welcher Genom oder Organismus
in ihren konkreten Ausformungen jeweils gebildet werden.
Einerseits müssen in beiden Fällen
die beiden Ausgangsstrukturen in je unterschiedlichen
Ausformungen im gemeinsamen Milieu existieren, weil nur so die ganz
besonderen Wirkungen von Variation und Selektion zustandekommen
können. Anderseits müssen die beiden Strukturen zueinander
ein hochgradiges strukturelles Verwandtschaftsverhältnis
aufweisen, wenn die spezifischen Wirkungen über den Effekt roher
Kraft hinausreichen soll. (Dass im Grenzfall rohe Kraft sowohl bei
der mutativen Variation wie bei der Selektion eine Rolle spielen
kann, tut dem Grundsatz keinen Abbruch.)
Konkret: das Genom "weiss" alles Wesentliche
über erfolgreiche Fortpflanzung der von ihm mitgebildeten
Organismus-Art. Das heisst auch, es "weiss" alles Nötige
über deren "normales" Milieu und beider Zusammenwirken. Weil all
dies im Genom verkörpert ist und im Organismus eine eigene
Ausformung erfährt, hat sich die Art ja gerade so
herausgebildet.
Der Organismus enthält in den
Keimzellen Genome, die in dem bekannten Milieu gleichartige
Organismen mitbilden können. Er verkörpert (!) dieses
"Wissen" und setzt es in einer unabhängigen Umgebung der
Bewährung aus. Die Bewährung besteht der Organismus und mit
ihm der Typus dieses Genoms freilich nur, wenn diese Umgebung dem im
Genoms vorgesehenen Genesekontext strukturell einigermassen
entspricht.
Dieses Kombinat von Entsprechung und
Unterschiedlichkeit lässt sich am besten als Affinität
bezeichnen. Strukturell affin sind einander, trotz der
völlig unterschiedlichen Erscheinungsweisen, Genom und
Organismus wie der Organismus und seine passende Umwelt.
Nun setzt aber das Zusammenspiel der beiden
Strukturen ein zweites Moment voraus, wenn mehr als ein Hin und Her
bedingt, wenn zum Dialog das evolutive Moment hinzutreten
soll.
Wenigstens eine der beiden Strukturen muss
dafür so angelegt sein, dass sie die im Dialog errungenen
Neuerungen aufbewahren und in der Fortsetzung des Dialogs zur Geltung
bringen kann. Bei der Bioevolution ist das ganz klar das Genom, in
welchem alle jene Variationen, welche die Selektion überstehen,
direkt zum Bestandteil des Genoms in einer Phylogenesereihe werden
und es auch bleiben. Dass die Aufbewahrung nicht eine simpel
additive ist, sondern mit zunehmender Komplexität auch die
Intensität von Querbezügen zwischen älteren und
neueren Errungenschaften ansteigt und Wirkungen höherer Ordnung
zustandekommen, kompliziert die Sache beträchtlich; dies
verleiht ihr sowohl mehr Vielfalt wie auch grössere
Kohärenz, macht sie aber wohl nicht grundsätzlich
anders.
Auf die Essenz gebracht: das Geheimnis oder
die Möglichkeit dialogischer Evolution liegt im Zusammenspiel
zweier affiner Strukturen in einem Milieu, von denen wenigstens
eine das Ergebnis des Zusammenspiel akkumulativ-integrierend
aufbewahren und im weiteren Zusammenspiel zur Wirkung bringen
kann. Dass es durch ihr gemeinsames Werden in einem
Milieu, durch Ko-Evolution der beiden Strukturen von selbst zur
besprochenen Affinität kommt, dürfte einsichtig
sein.
Ich habe jetzt das biotische
Entwicklungsgeschehen auf der Ebene von Vorgangstypen beschrieben;
dergestalt freilich, dass es sich um konkrete Vorgänge in der
Zeit handeln muss. Lassen Sie mich noch anmerken, dass mir zwei
gängige und bloss allgemeine Redeweisen über diesen Vorgang
gleicherweise beschränkt erscheinen: nämlich (a) die
Organismen bedienten sich der Gene für ihr Überleben als
Art; und (b) die Gene bedienten sich der Organismen als ihre
Überlebensmaschinen (Dawkins). Das ist magischer Kartesianismus.
In gängigen Redeweisen kann anscheinend alles und jedes ein
Subjekt sein. Wenn es nur metaphorisch gemeint sein sollte, dann ist
es eine irreführende Metapher. Denn man muss doch sehen, dass
die beiden Strukturen einander wechselweise bedingen. Keine hat
Primat. Sie tragen einfach unterschiedliche Funktionen ein- und
desselben Entwicklungsvorgangs. Auch wenn uns die Entwicklung der
Organismen eindrücklicher erscheint, ist in Wirklichkeit die
komplementäre Entwicklung des gesamten Milieus auf der
Planetenoberfläche, zu der alle Arten beitragen, viel
nachhaltiger und tiefgreifender.
Und zweitens wäre es völlig
irreführend, wenn man das evolutive Werden einer Species als
isolierten Vorgang auffassen würde. Alles geschieht in einem
unglaublich vielfältig facettierten Gesamtsystem von
symbiontischen und antagonistischen Untersystemen, das wir sehr
unzureichend das Milieu oder das Biotop nennen und das eher durch
Differenzen von Erscheinungen als durch Charaktere von Substanzen zu
charakterisieren ist. Für die Bioevolution stellt das Milieu zur
Hauptsache Stoffe und Energie zur Synthese der Strukturen bereit. Was
die Selektionsfunktion betrifft, werden freilich auch die
spezifischen Formungen der Stoffe und Energien des Milieus relevant;
denn es müssen Artgenossen, Beute und Feinde erkannt, Symbionten
spezifisch versorgt und günstige und ungünstige
Konstellationen des Milieus gesucht oder gemieden werden.
Die Bedeutung des Gesamtsystems von
dialogisierenden Strukturen in ihrem Milieu durch die Zeit will ich
Ihnen durch den Gedanken nahebringen, dass die Oberfläche
unseres Planeten sehr anders aussähe ohne diesen evolutiven
"Multilog", den wir Natur nennen und immer noch meistens für
gewissermassen gegeben halten. Er ist geworden und ist weiter im
Werden. Es hätte an unendlich vielen Stellen alles auch ganz
anders laufen können. Beispielsweise ist der Sauerstoffgehalt
der Atmosphäre ein gemeinsames Produkt des Zusammenspiels von
assimilierenden und produzierenden Tieren und Pflanzen.
1.6. Individualgenese und
Person-Kultur-Wandel
Das Modell der Bioevolution lässt sich
nun als Denkhilfe einsetzen, um die Ko-Evolution von lernenden
Individuen in ihrer Umwelt und, insbesondere, um die Ko-Evolution von
Personen in der Kultur zu verstehen. Beachten Sie meine
Ausdrücke: als Individuen entwickeln sich ontogenetisch
alle etwas komplexeren Tiere; sie werten eigene Erfahrungen in ihrem
um- und mitweltlichen Milieu für ihr Fortbestehen und
Fortpflanzen aus. Als Personen entwickeln sich Lebewesen, zur
Hauptsache Menschen, welche eigene Erfahrungen nicht nur selber
verwerten, sondern an andere Individuen im Sozialsystem in einem
vermittelnden Verfahren weitergeben, in einer Kultur einander
zugänglich machen können, indem sie ihre Umgebung
systematisch verändern. Doch ist das nicht als scharfe
Opposition zu verstehen, sondern eher als Fortsetzung von
umweltgestützten Bindeverfahren im Sozialsystem mit andern
Mitteln. Denn systematische Umgebungsveränderungen zur
Bestimmung der andern kommen schon auf Stoffwechselebene und
besonders durch Instinkte zustande; man denke an Körperformen,
Nahrungskulturen, Pheromone, Lautäusserungen, Höhlen- und
Nestbau u.a.m.
Wohlverstanden, da gibt es grundlegende
Unterschiede zur Bioevolution. Der entscheidende liegt darin, dass
jede individuelle Genese wie jeder Person-Kultur-Wandel ein
bestimmtes biologisches Gebilde voraussetzt, das wir gewöhnlich
vereinfachend als Typus einer Species erfassen. Dessen genaue
Beschreibung müsste allerdings seine affine Umwelt
miteinbeziehen; denn ohne solche kann es gar nicht existieren,
geschweige denn individuell oder kulturell evoluieren. Man denke
dabei nicht nur an den Stoff- und Energiewechsel, sondern auch an die
auf viele relevante Eigenschaften der normalen Umgebung bestens
ausgerichteten Sinnes- und Verhaltenssysteme: an die Korrespondenz
zwischen der eigenen raum-zeitlichen Organisation mit den
umweltlichen Verhältnissen; an das Umgehenkönnen mit
Schwerkraft, mit Mechanik, mit Stoff- und Formvarietäten bei der
Nahrungs- und Partnerwahl, mit Vibration beim Hören und
Lautäussern im sozialen Verband; an das "sonnenhafte Auge", das
in Licht getauchte Umwelt in Farben und Formen und Bewegung
darstellt.
Individueller und kultureller Wandel
gründen also auf solchen Organismen und ihrer affinen Umwelt.
Unter veränderten Verhältnissen werden die evolutiven
Prozesse anderen Bedingungen folgen. Aber können wir nicht
erwarten, dass bei der Individualgenese und beim Person-Kultur-Wandel
jene grundlegenden Prinzipien des strukturgenerativen Dialogs affiner
Strukturen und der Aufbewahrung und Nutzung von bewährten
Errungenschaften erneut zum Tragen kommen? Auch wenn sich anstelle
von Genom und Organismus eine ganz neue strukturelle Basis ihrer
Prozesse und ihrer Bildung herausgebildet hat. Dass der kulturelle
Wandel den Charakter offener Evolution hat, wird niemand bestreiten
wollen. Individualgenetische Entwicklung endet zwar mit dem Tod des
Individuums; doch auch sie hat weder ein erfüllbares Ziel noch
einen vorhersehbaren Weg.
Suchen wir nach Gebilden in den beiden
Bereichen, welche die entsprechenden variativen und selektiven
Leistungen erbringen können. Wieder beschreibe ich den
evolutiven Dialog auf der allgemeinen Ebene des Typus. Und ich nehme
nun jedoch direkter Bezug auf ihr Werden.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass in
komplexern Organismen die Herausbildung von Zentralvervensystemen
eine entscheidende Voraussetzung für individuelle
Entwicklung sein muss. Wie das Genom die Erfahrung der Vorfahren
akkumuliert und integriert das ZNS die individuumseigenen
"Erfahrungen" als dynamisches "Wissen" und "Können", das
später zur Geltung kommen kann, freilich auf eine ebenfalls
andere, viel direktere Weise.
Die kleinen Kätzchen lernen z.B.
früh im Leben ihre Mutter von andern Katzen unterscheiden; im
Spiel erwerben sie das Umgehen mit Mäusen u.v.a.m. Anders
könnten sie nicht ohne menschliche Hilfe überleben. Die
Instinkte, deren Bedingungen im Genom aufgebaut worden sind,
bestimmen und sichern zwar dieses Interaktionsgeschehen und
differenzieren damit die Affinität zwischen Kätzchen,
Katzenmutter und Umwelt. Aber zusätzlich kommt es nun zu
neuartigen Strukturbildungen im ZNS jedes Individuums: das
individuelle Gedächtnis als Basis von Können, Wissen,
Verstehen, Erwarten usf. Die Affinität zwischen Individuum und
Umwelt bleibt erhalten, aber die Lebewesen zeigen zunehmend
vielfältigere Variationen zugleich mit Konsolidierungen, je
länger sie leben. Sie erwerben, infolge der Interaktion mit der
im Fliessen konstanten Umwelt, zunehmende
Individualität.
Nicht übersehen sollten wir dabei die
vielen kleinen Umweltveränderungen, die das interaktive
Geschehen selbst hinterlässt, wie das Trampeln von Pfaden, das
Setzen von Duftmarken, der Nestbau u.v.a.m. Der Vorgang ist dennoch
zur Hauptsache ein asymmetrischer: die Strukturen der Umwelt bleiben
weitgehend konstant bzw. variabel in sich selbst wie im Tages- oder
Jahresverlauf; vor allem werden durch den Umgang mit Umwelt die
Strukturen im ZNS differenziert und angereichert, analog denjenigen
des Genoms, wenngleich in einem ganz anderen Strukturbildungsvorgang.
Soweit zur Entwicklung innerhalb individueller
Lebensläufe.
Betrachten wir jetzt die noch interessantere
kulturell getragene Entwicklung. Zwischen derart
individualisierten Lebewesen kann es, wenn sie untereinander in einem
gemeinsamen Milieu interagieren, zu Problemen kommen. Je mehr sie
über die Instinktbasis hinaus sich individualisieren, je mehr
jedes seine eigene Art des Umgangs mit der Umwelt herausbildet, desto
mehr werden sie Nachteile beim Zusammenleben dafür einhandeln.
Trotz des gemeinsamen umweltlichen Milieus werden deshalb die
Affinitäten zueinander tendenziell abnehmen. Solche Risiken
bedürfen wohl der Kompensation.
Schlagwortartig sage ich, es kam irgendwann
die Stunde in der Menschwerdung, vor ein paar hunderttausend Jahren
vielleicht, und immer wieder danach bis heute, wo
Sozialisierung der Jungen wie bei den Katzen nicht mehr
ausreichte, sondern durch Enkulturation ergänzt werden
muss. Was meine ich mit meiner eigenwilligen Opposition der beiden
Begriffe, die meist eher parallel gesehen werden?
Sozialisierende Instanzen
konzentrieren ihre Bemühungen, den Grad der Affinität der
Strukturen im Sozialsystem zu erhöhen, also aus allen anderen
Mitgliedern des Sozialsystems hochaffine Partner zu machen, auf jedes
einzelne real oder potentiell abweichende Individuum. Dessen ZNS
(entschuldigen Sie den Jargon, ich meine einfach diese
organismus-internen erfahrungsgebildeten Strukturen welche alles
Handeln und weitere Strukturbilden mitbestimmen; das sei ohne
Präjudiz über die brauchbaren Erfassungsweisen solcher
Strukturen noch gar über deren ontologischen Charakter;
bevorzugt spreche ich vom Brain-Mind oder, synonym vom Mind-Brain,
weil das seine mentalen und materialen Aspekte zusammenbringt), das
Brain-Mind jedes Einzelnen soll so affin wie möglich, die
Abweichung für die Sozietät so unschädlich wie
möglich gemacht werden.
Enkulturation oder Kultivation geht
jedoch einen ganz anderen Weg. Sie baut auf die bedeutende Rolle des
gemeinsamen Milieus. Sie induziert Veränderungen in erster Linie
der gemeinsamen Umwelt. Natürlich erzeugt sie, in affiner Weise,
Umweltstrukturen, die mit Innenstrukturen korrespondieren. Und
überantwortet dann die individuelle Entwicklung bis zu einem
gewissen Grad den Auseinandersetzungen der Enkulturanden mit dieser
kulturellen Umwelt. Das bringt ein unerhörtes Potential an
Rückkoppelungen, weil ja die Entwicklung der individuellen
Innenstrukturen der Mitglieder einer Gruppe durch diese neuen
Aussenstrukturen ungemein angeregt werden. Damit wird leichter so
etwas wie komplementäre Ko-evolution von aussen und innen
erreicht. In der Tat wirkt ja die eigene Erfahrung beispielsweise
einer riskanten Grenzsituation nachhaltiger als hundert Warnungen vor
Gefahr.
Sozialisation und Kultivation, die
einander im konkreten Prozess durchaus komplementieren, aber auch
konfligieren können, sind mithin zwei Strategien zur Sicherung
und Erhöhung der Affinität in sozialen Systemen.
Natürlich treten sie im Alltag kombiniert auf; aber in
unterschiedlicher Gewichtung. Sozialisierung scheint zweier Subjekte
zu bedürfen, eines in der Rolle eines Objekts; ist also eher
kartesianisch; frustriert sich, wenn sie scheitert, reagiert dann
vielleicht mit Wut und Macht. Hat ja oft auch eher traurige Ziele:
die Gleichmacherei. Sozialisation sucht gezielten und direkten
Einfluss auf die Binnenstrukturen von Sozietätsmitgliedern;
Enkulturation tut dasselbe indirekt über die gemeinsame
Umwelt.
Kultivation ist leiser und effizienter.
Nicht weniger mächtig mit den vielen Dingen, Ködern und
Sachzwängen, die sie auslegt. Aber sie hat kein einzelnes
Subjekt noch ein bestimmtes Ziel-Subjekt-Objekt. Ein Enkulturierter
muss nicht wie ein Sozialisand in Ohnmacht resignieren, nachgeben
oder re-agieren, sondern kann "gegen-enkulturieren". Kann seinerseits
Dinge in die Welt setzen, welche die andern mitbestimmen.
Enkulturation ist wesentlich symmetrischer. Der "Preis" dafür
ist das Risiko wachsender Diversität und zunehmender Ab- und
Ausgrenzungen. Das kann man wünschen oder zu verhindern suchen,
beides mit guten Gründen. Freilich sollte man den Vorgang besser
zu verstehen suchen, bevor man mit Gesetz oder Gewalt das eine oder
andere durchzusetzen versucht.
Und Enkulturation ist nachhaltiger, zeitlich
und räumlich. Viele von den Dingen und Raumstrukturen, die wir
durch Gestalten, Bauen, Anordnen in die Welt setzen, überdauern
die individuellen Lebensläufe. Und sie wirken jederzeit und
langezeit auf viele Personen. Wer Dinge irgendwelcher Art, mit
welchen andere interagieren, in die Welt setzen kann und wer deren
Vervielfältigung beherrscht, gewinnt Macht in einem Ausmass,
wovon sozialisierende Herrschaft nur träumen kann. Wer Kirchen
und Städte, Häuser und Strassen, Kleider und Fernsehen
macht, bestimmt unseren Tag und unsere Zeit wie kein Imperator mit
dem grössten Heer von Soldaten und Pädagogen nicht.
1.7. Struktur und Prozess im
ökologischen Funktionskreis
Jakob von Uexkülls
Funktionskreis-Begriff dürfte unter Semiotikern wenigstens
dem Namen nach bekannt sein. Er betrifft das Prinzip, dass jede
Species durch die sie charakterisierende Eigenstruktur und deren
Funktionieren auf ihre je eigene Art auf ihre eigene
Umwelt bezugnimmt und so erst indirekt auf die reale Umgebung
oder Welt. Das betrifft sowohl ihre orientierenden (Merkwelt) wie
ihre umweltverändernde Bezugnahme (Wirkwelt). Wie es von
Uexküll schon angedeutet hat, lässt sich das Prinzip auf
die Ontogenese der Person und auf den Wandel in der Kultur ausweiten.
Und erweist sich als äusserst fruchtbar.
Nehmen Sie an, dass grundsätzlich jeder
Merk- oder Wahrnehmungsvorgang im aufnehmenden System etwas
hinterlässt, worauf sofort oder später weitere Prozesse
gründen können. Es macht keinen prinzipiellen Unterschied,
ob solche Wirkungen eher flüchtig oder andauernd, fixiert oder
variabel sind; alle haben sie das Potential, im System jetzt oder
später eine weitere Veränderung zu bewirken. Die
überdauernden Erfahrungswirkungen, Gedächtnisbildungen sind
freilich wohl die entwicklungsbestimmenden.
Das gilt in ähnlicher Weise für
die Wirk- oder Handlungsvollzüge. Jeder Akt bewirkt eine kleine
"Weltveränderung". Ich meine nicht "Verhalten des Organismus",
sondern analog dem Wahrnehmen eine "intentionale" oder bezogene,
nämlich handelnde, potentiell auf seine Weise etwas bewirkende
Bezugnahme des lebenden System auf die umgebende Welt. Sie kann
flüchtig sein wie Lautäusserungen oder Gesten; sie kann
andauernder wirken wie Ortsveränderungen des Lebewesens selbst
oder von Dingen oder wie Verformung von Dingen in Werken, seien dies
Gebrauchsgegenstände, Kunstwerke oder Raumstrukturen. Mit
Geräten lassen sich die Wirkungen verstärken bis zum Berge
versetzen.
Es geht um Strukturbildungen, die in der
Welt etwas hinterlassen, was in neuerliche Wahrnehmungsprozesse, der
Handelnden selbst wie von anderen, eingehen kann. Voraussetzung dazu
ist, dass diese hergestellten Aussenstrukturen den Innenstrukteren
der andern im Sozialsystem ausreichend affin sind. So entsteht die
gemeinsame Welt einer Kultur. Ich betone noch einmal die
Affinitätsfrage: Aussenstrukturen können nur
enkulturierende Wirkungen auf andere haben, insoweit sie Gemeinsames
zeigen. Die Kultur ist weder innen noch aussen, sondern
überspannt Individuen und ihre gemeinsame, selbstgeschaffene
Umwelt.
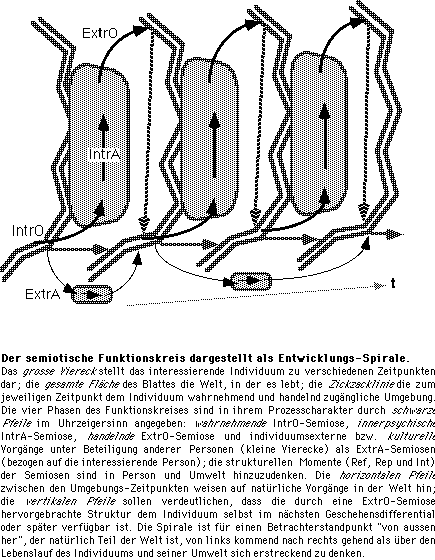
Abbildung 1.
Funktionskreisspirale
Lassen Sie mich zwei praktische Begriffe
einführen (vgl. Abbildung 1):
IntrO für die in Personen oder
Teilsysteme hineinwirkenden Prozesse zu internen
Strukturbildungen.
ExtrO für die aus Personen oder
analogen Teilsystemen hinauswirkenden Prozesse zur externalen
Umweltveränderung.
ExtrO-Vorgänge verkörpern
Innenstrukturen nach aussen und machen sie damit auch andern
zugänglich. IntrO-Vorgänge verkörpern (ebenfalls!)
Aussenstrukturen, nämlich in einem individuellen Brain-Mind.
Dies freilich auf eine nicht recht bekannte Weise in einer Welt
für sich. Diese können wir in gewissen ihrer
Erscheinungsweisen biochemisch-neuronal grob beschreiben, in ihrer
Wirkungsweise aber nur generell verstehen. Denn entscheidend ist
nicht, obgleich unentbehrlich, wie sie biochemisch-neuronal
funktionieren; sondern dass sie dort, aktuell oder später,
erneut zu Wirkungen ungeahnter Tragweite gebracht werden können.
Denn innerhalb des Brain-Mind haben fast alle Strukturen als
neuronale Prozesse zum vornherein untereinander einen hohen
Affinitätsgrad zumindest in formaler Hinsicht. Diese
Binnenstrukturen sind fast vergleichbar einem Haus oder einem
Stück Geld oder einer Sprache, denen wir ja auch nicht ansehen
können, was sie alles bewirken können.
ExtrOs, also Handlungen und ihre
Wirkungen, bieten etwas an, einem selbst und anderen. IntrOs
können Angebote aufnehmen und weiterführen, sofort oder
später. Das Angebotene kann freilich auch liegenbleiben.
Vielleicht irgendwann später "ausgegraben" werden, aber auch
völlig verloren gehen wie die Abermillionen von
ausselektionierten bioevolutiven Species der vergangenen gut 3
Milliarden Jahre auf der Erde.
Nun bilden aber IntrOs und ExtrOs in Folge
Genesereihen, bei instinktgetragenem Verhalten wie erst recht bei
Angeboten und Aufnahmen in einer Kultur. Im Wechsel von Struktur und
Prozess überspannen sie Zeit. Im allmählichen Wandel der
Intern- und Extern-Strukturen bei beider grundsätzlichen
Konstanz bedingen sie Entwicklung. Der akkumulierend-integrierende
Charakter sowohl der persönlichen Innen- wie der
sozio-kulturellen Aussen- oder Gemeinsamstrukturen führt in
ihrem Dialogisieren zu einem spiraligen Geschehen, also zu
gemeinsamer Evolution.
Inhalt
2.
Elementar-Semiotik
Damit komme ich endlich zur Semiotik.
Für das bisher gezeichnete inhaltliche Bild vom evolutiven
Dialog suche ich eine allgemeine Form. Denn er ist so grundlegend
für die Konstitution unserer Welt, dass wir damit nicht nur
sprachlich umgehen sollten. Wir bedürfen allgemeiner
Darstellungsverfahren, welch kontrollierten und kontrollierbaren
wissenschaftlichen und praktischen Umgang mit dessen Inhalten
ermöglichen. Wie beschreiben wir diesen Genesedialog, dessen
entscheidende Charakteristika wir auf bisher drei Entwicklungsstufen
lebender Systeme als gleichartig, obgleich mit unterschiedlichen
Trägern realisiert, aufgezeigt haben?
Bei dieser Aufgabe ist mir Charles
Peirce die entscheidende Hilfe geworden (für das
Wesentliche empfehle ich Peirce 1992). Aber ich werde ihn aufnehmen
und zugleich möglicherweise die "Schule" sprengen, wenn es denn
so etwas geben sollte. Peirce's Angebote seiner Konzeption der
Semeiose sind zu kompliziert und zu vieldeutig, wie
revolutionär, raffiniert und fruchtbar sie auch sind. Man kann
sie offenbar nicht so verwenden wie sie formuliert sind oder gedeutet
werden, wenn sich nicht einmal die Experten darüber einig werden
können (Short 1986). Peirce hat im Lauf von über 40 Jahren
an die einhundert Varianten seines Zeichenbegriffs aufgeschrieben.
Hat er keine ihn befriedigende gefunden? Ein so grundlegender Begriff
wie der der Semiose muss im Grundgehalt von der Frau auf der Strasse
kapiert, angeeignet und irgendwie verwendet werden können, wenn
er die kartesianischen Dualismen und ablösen und die zweiwertige
Logik und die notwendige Verursachung zum Spezialfall relativieren
können soll.
Peirce ist dennoch einmalig innovativ in
seinen konstruktiv-kritischen Neudeutungen der abendländischen
Wissenschafts- und Kulturgeschichte und er bietet bis heute von den
differenziertesten und meistversprechenden Schritten zu einer
Theorie der evolutiv-generativen Dialogik an.
Eine von Peirces anstössigen Ideen war,
wie schon angedeutet, die Behauptung gegen den kantischen
Kartesianismus, dass Gedanken sowohl innerhalb wie ausserhalb von
Mind-Brains seien und daher ein Begriff wie "Mind" einen viel
allgemeineren Sinn erhalten solle (vgl. mehrere Arbeiten von 1867 an
in Perice 1992). Dass wir über unsere Gedanken "innerhalb"
direkt nichts Vernünftiges ausmachen könnten, sondern nur
die äusseren uns zugänglich seien. Dass also die externalen
uns die einzigen Möglichkeiten böten, auch mit den inneren
umzugehen. Dass aber letztlich kein wesentlicher Unterschied
bestünde, da beide als zeichenhaft verstanden werden
könnten. Und wohl auch, dass sie zusammenspielen müssten in
einer allgemeinen Kontinuität. Dass es daher wohl klüger
wäre zu sagen, wir, als Personen, seien in Gedanken, als zu
glauben, die Gedanken seien in uns. Und dass, wenn Personen, als
einzelne oder als "Corporate Persons", z.B. soziale Systeme, aus
zeichenhaften Gedanken konstituiert seien, wir als Menschen, wie
andere Lebewesen und ihre Verbände auch, natürlich Zeichen
oder zeichenhaft seien. Halt so etwas wie örtlich stärker
verdichtete Zeichenkondensationen, vergleichbar den Galaxien oder
Sternhaufen im Kosmos. Aber kaum klar abzugrenzen untereinander, und
uns nur je nach unserer Betrachtungsweise einheitlich oder verteilt
erscheinend. Und unsere Umwelt, insbesondere die kulturelle, sei
natürlich ebenso eine zeichenhafte.
Und diese so gesehene Sachlage erlaube mit
Selbstverständlichkeit zu begreifen, dass so etwas wie das, was
wir in der abendländischen Kultur als erkennende und agierende
"Subjekte" erlebten, natürlich eine soziale Konstruktion sei
(hier erlaube ich mir der Kürze halber, Peirce's klare Einsicht
in einen modernen Ausdruck zu fassen). Gewissermassen ein
Unglücksfall oder ein Holzweg des evolutiven Dialogs, so etwas a
priori zu setzen und seine Eigenschaften in Tafeln zu fixieren,
anstatt es als Ergebnis von evolutiven Dialogen zu verstehen und es
empirisch zu untersuchen. Die Aufgabe sei, so präzise und
realistisch wie nur möglich, mit logisch kontrollierter
Wissenschaft, aufzuzeigen, worin solche Phänomene, die wir
"Subjekt" oder "Geist" nennen, möglicherweise bestehen, was ihre
Voraussetzungen seien und ihre Wirkungsweisen sein
könnten.
Ich hoffe, Sie können mir auf diesem
Hintergrund folgen, wenn ich nun mitten in die Semiotik springe und
zu zeigen versuche, wie ich Semiose auffasse, und ein bisschen
andeute, wie man damit umgehen kann.
2.1. Semiose als Produktion oder
Strukturbildung
Nehmen wir den am besten beobachtbaren
ExtrO-Vorgang aus dem Funktionskreis als Modell für alles
weitere. Semiose als Prozess ist für mich
Strukturbildung oder -aktualisierung im aktuellen Vollzug
einer Dreifachrelation. Ich meine das als eine sehr allgemeine These,
die sich auf einen weiten Bereich von Erscheinungen bezieht, von
molekularen Vorgängen bis zu Aspekten des sog. Weltgeschehens.
Möglicherweise reicht diese These im Ursprung auf Vorbiotisches
zurück; sicher betrifft sie in gewisser Hinsicht auch
Nachbiotisches wie Computer. Aber bleiben wir bei unserem
exemplarischen Fall im Funktionskreis von Lebewesen.
Man darf sinnvollerweise annehmen, ein
umweltverändernder Akt eines Lebewesens beruhe auf einem
bestimmten aktualisierten Zustand gewisser Teile des Innensystems.
Natürlich muss man sich das Brain-Mind stets in einem aus einer
sehr infiniten Menge solcher Zustände denken. Man stellt sich
metaphorisch vor, dass viele potentielle solche Zustände um
Dominanz "ringen" und einer jeweils herausragt und das Geschehen
bestimmt. Wir "schauen" jetzt per Inferenz gerade dann in das System,
wo ein solcher Zustand ausgezeichnet ist und damit zum
Ausgangszustand für Weiteres wird. Ein solcher Zustand kann dazu
führen, dass gewisse andere Teile des Systems, nennen wir sie
das Exekutiv(sub)system, in der ihnen eigenen Weise diesen internen
Zustand als ihren Referenzzustand in eine externe
Weltveränderung umsetzen. Das beschreiben wir als einen
ExtrO-Prozess oder als Handeln im weiten Sinn.
Wir haben damit drei Komponenten eines
analytisch differenzierbaren, aber als Triade einheitlichen Vorgangs
evoziert. Als Prozess ist er ein gerichteter Vorgang, darstellbar als
der semiosische Pfeil (Abbildung 2). Er vereint untrennbar
drei Relata:
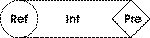
Abbildung 2 Der semiosische
Pfeil
[1] eine Quelle oder
Ursprung. Ich spreche im konkreten Fall am liebsten vom
Referenten, allgemein von der Referenz; es gibt
Querbezüge zum Peirce'schen Objekt, aber darauf einzugehen
würde jetzt nur verwirren.
[2] eine Vermittlung oder
Umsetzung, vergleichbar etwa einer Sprache, in die und durch die
übersetzt wird. Sie nimmt ein Merkmal vom Referenten auf und
muss die Umsetzung in neuer und eigener Weise darstellen. Ich
nenne diese Komponente oder Kraft deshalb den Interpretanten (als
Token) oder allgemein (als Type) die Interpretanz,
weil genau das geleistet wird: eine Umsetzung einer Sache in eine
andere. (Vielleicht unterdrücken Sie für eine Weile
Ihren eigenen Zeichenbegriff!) Dies dergestalt, dass weder die
umgesetzte noch die umsetzende Instanz je allein das Ergebnis
bestimmt, sondern beide zusammen untrennbar vermengt sind, wie bei
Kants ursprünglicher Einsicht, dass Erkennendes und Erkanntes
nicht voneinander zu lösen seien.
Der Interpretant ist mithin weder aktiv noch
passiv, allenfalls beides, oder lieber keines von beiden. Die
Endsilbe -ant oder -ent (bei Referent) scheint diese
Ambivalenz auszudrücken. Wenn sich die Konnotation von Agens und
Erleidendem vermeiden liesse, könnte man auch von Umformung oder
Transformation sprechen. Unter gewissen Gesichtspunkten bewährt
sich der Begriff der Anaformation, insofern das vielsinnige
Präfix "ana-" sämtliche analog oder konträr
ikonischen, kausal oder kontingent indexikalischen und arbiträr
symbolischen Bezugsweisen markieren kann.
Auch hier besteht ein Querbezug zu Peirce's
Interpretant, insofern es sich bei meiner Interpretanz um ein
vermittelndes, mediating Third handelt. Es gibt manche
Peirce-Stelle, die den Interpretanten prozessbezogen in dieser
vermittelnden Funktion darstellt; üblicher geworden ist
allerdings, bei ihm selbst und dann bei seinen Interpreten fast
ausschliesslich, die in logischer Hinsicht angezeigte Vorstellung vom
Interpretanten als einem resulting Third, nämlich der
(Reihe von) Interpretation(en), die ein Zeichen in einem "Mind"
gewinnen kann.
Im Anschluss daran entstand wohl die meines
Erachtens völlig irreführende, vielleicht aus
traditioneller Semiotik und Saussureanisch induzierte Deutung vom
Interpretanten als der Bedeutung eines Zeichens. Das kann leicht zum
Rückfall nicht nur in dyadische Zeichenlehre, sondern auch in
kartesianischen Dualismus werden, ist es zumindest der Ausdrucksweise
nach. Das so unübersichtliche Feld der Semiotik ordnet sich in
meinen Augen beträchtlich, wenn man signifikative und denotative
Zeichen-Bedeutungs-Zuordnungen als degenerierte Triaden (mit
implizierter Interpretanz) versteht. Nicht-dualistisch meint
Bedeutung eine vermittelte Wirkung und dann ein Wirkungspotential. In
gewissen Sinn steht meine Auffassung der Semiose mit dem
vermittelnden Dritten der Peirce'schen Kategorie der Drittheit
näher als seinem Zeichenbegriff.
[3] ein Resultierendes oder
eine Darstellung des Zusammenspiels von Referenz und Interpretanz.
Das Umgesetzte wird mit seiner Umsetzung als neue oder
aktualisierte Instanz dargestellt. Es präsentiert die
Begegnung von Referent und Interpretant für spätere
Aufnahme (oder zum Verlorengehen). Ich bezeichne es deshalb als
Präsentant im Prozess oder allgemein als
Präsentanz. Das ist semiotisch
ausgedrückt, was ich im Funktionskreis als Angebot des
Handelns bezeichnet habe. Präsentanten machen Semiosen
strukturell verfügbar, jetzt oder später. Sie
präsentieren ihre Bezugnahme auf ihre Referenzen und
Interpretanzen in neuer Darstellung.
Die mehrschichtige Beziehung zur Peirce's
Repräsentamen oder Zeichen im engeren Sinn kann ebenfalls
hier nicht erläutert werden. Verwechseln Sie aber
Präsentanz keinesfalls mit der (symbolischen)
Repräsentation der kognitiven Wissenschaften. Peirce hat
diese Unterscheidung klar gemacht. Die anfänglich von mir
verwendete Vorsilbe (Re-)präsentanz ist unnötig und
leicht irreführend.
Im Gegensatz zu fast der gesamten
semiotischen Praxis bemühe ich mich, mit Bestimmtheit zur
Diskussion zu stellen, dass wir Peirce's These ernstnehmen sollten,
ein Zeichen sei, was in ein neues Zeichen umgesetzt werden
könne. Oder die Bedeutung eines Zeichens sei sein Gebrauch im
Leben, um Wittgenstein zu paraphrasieren, der das angemessen, aber
vielleicht etwas zu sehr vom Sprachlichen her gesehen hat.
Die Kernthese dieses Vorschlags fordert,
Semiose sei nicht so sehr als Interpretation sondern vielmehr als
Produktion von Zeichen zu verstehen oder, anders gesagt, wir
sollten die Interpretation von Zeichen als die Produktion von
neuen Zeichen interpretieren und dies konzeptuell und praktisch
auch durchführen. Zeichencharaktere haben aussschliesslich reale
Strukturen; also beschreibt Semiose die Bildung oder die
Aktualisierung von realen zeichenhaften Strukturen.
Auch durchführen sollten wir die
produktive Sicht der Semiose, sage ich, weil ich mich des Eindrucks
schwer erwehren kann, dass etliche Semiotiker sich zwar die Redeweise
von der infiniten Zeichenproduktion zu eigen gemacht haben, faktisch
aber bei der Interpretation von Zeichen im Sinne des Explizierens von
Bedeutung bleiben. Ich brauche hier keine Namen zu nennen; es
wären ihrer zu viele.
Einer der seltenen Semiotiker, der die
Zeichengeneration in den Mittelpunkt seines Denkens zu stellen
begonnen hatte, war Gerold Ungeheuer (1987, posthum), in voller Kraft
leider erst kurz vor seinem vorzeitigen Tod, und damit weitgehend
bloss programmatisch. Ich verdanke diesen Hinweis Ernest
Hess-Lüttich. In gewisser Weise tut dies auch Gerhard
Schönrich (1990) mit seiner Deutung der Semeiose als
Zeichenhandeln. Er bindet dies an den vorkritischen Kant an und es
wird zu untersuchen sein, inwiefern hier neben der Semiotik von
Lambert die Herder'sche Denkweise eine ihrer Wurzeln hat. Freilich
bleibt er wie die meiste moderne Handlungstheorie vorwiegend im
Geistigen und betrachtet ebenfalls kaum die realen Wirkungen von
Handlungen.
Was heisst Semiose als
Strukturbildung? Ich kann hier nur die Linie skizzieren, entlang
der ich Wege suche, dies zu explizieren, und werde sie später
noch etwas auszeichnen. Eine, wie mir scheint, eingängige und
versprechende Formel besagt, dass zwei strukturelle Gebilde, sofern
sie geeignete Affinitäten zueinander aufweisen und dennoch
unabhängig voneinander existieren, in ihrer Begegnung ein
drittes Gebilde erzeugen können, welches aus keinem der beiden
Gebilde allein prädizierbar ist und dennoch wieder
Affinität zu beiden aufweist.
Sie können gerne, und wiederum
zunächst biotisch, als Modell die geschlechtliche Zeugung
nehmen. Mann und Frau erzeugen ein Kind. Die aktuelle Zeugung, das
Zusammentreffen bestimmter Gameten, ist sehr zufällig, obwohl
die beiden Rahmenstrukturen für solche Akte vorbereitet sind und
oft einiges unternehmen, um zusammenzukommen. Das ist nichts als
Affinität, bin ich versucht zu sagen. Sie können auch einen
Ideenkomplex als Referent und eine Sprache als Interpretant nehmen,
die zusammen so etwas wie ein Buch erzeugen oder präsentieren.
Oder, um auf unser Wohnbeispiel zurückzugreifen, bei Hans etwa
die Feststellung eines leeren Treppenabsatzes, die zusammen mit
einigen Erfahrungen über Wohnen die Idee einer Arbeitsplatte
hervorbringt, der dann die Ausführung folgt. Aber ich greife
vor.
2.2. Semiotischer Funktionskreis:
ExtrO-, IntrO-, IntrA-Semiose
Zunächst will ich diese
Semiosekonzeption auf die personnahen Phasen des spiralenden
Funktionskreises anwenden.
Im konkret-aktuellen Prozess erzeugt also
eine ExtrO-Semiose ein externes Zeichen, nehmen wir zB die
frisch montierte Tischplatte in dem was später Büro 2b bei
Hans wird. Natürlich folgen darauf, wenn Hans einen Stuhl
hinträgt und sich an die Platte setzt eine ganze Reihe von
perzeptiven und kognitiv-emotiven Verarbeitungsprozessen, in denen
Hans diese "neue Weltlage" zur Kenntnis nimmt und seine Kenntnis
über diese Weltlage, also seine Innenstrukturen, sein
Handlungssteuerungssystem, sein Heimgefühl, etc. etc., auf die
neue Lage "ausrichtet". Ich sage weder "anpasst", noch "angleicht",
weil es etwas Eigenes bleibt.
Man kann sich hier unendlich viele
IntrO-Semiosen kleinerer und grösserer Reichweite und von
unterschiedlichem Zeithorizont vorstellen, alles reale Ereignisse im
System Hans-Wohnung, ineinander verschachtelt und mit den
ExtrO-Semiosen des Orientierungsverhaltens verwoben. Es ist aber
unsere, der Beobachter oder Forscher, Sache, auf welchem Horizont
oder welchen Horizonten wir unsere Darstellung von Semiosen empirisch
durchführen, als Mikroprozesse vielleicht in physiologischen
wenn nicht gar in molekularbiologischen Darstellungsformen, als Meso-
oder Makroprozesse auf der Basis von Beobachtungen und Inferenzen
über perzeptive und kognitive und aktionale Darstellungen oder
gar auf der Basis der gemeinsamen Lebengeschichte von Hans und Silvia
und ihrem Haus.
Bemerkenswert ist, dass Hans mit ExtrO- und
IntrO-Sequenzen den Funktionskreis mehrfach auf dem Weg über
seine Umwelt schliesst und stets gleich wieder zu neuen evolutiven
Folgesequenzen aufnimmt; denn die Lage innen und aussen ist vorher
nicht so gewesen, wie sie durch jedes IntrO- oder ExtrO-Schrittchen
wird. Hans wird vielleicht Schubladen, Gestelle, gutes Licht und was
weiss ich vermissen und sich das in Ketten von weiteren IntrO- und
ExtrO-Prozessen real und kognitiv, aussen und innen in affinen
Strukturen, aufbauen.
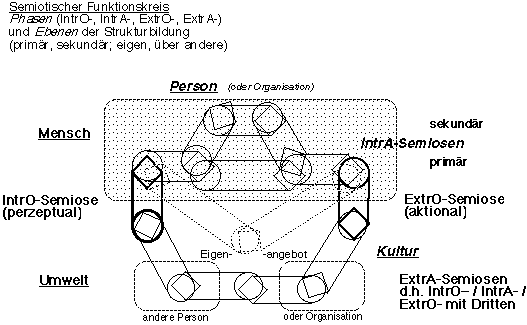
Abbildung 3 Semiotischer
Funktionskreis
Damit muss ich einen bisher ausgeblendeten
Teil des Funktionskreises aufnehmen, der bei von Uexküll
durchaus schon mitgedacht wird: Denn zwischen der IntrO- und der
ExtrO-Phase kann weiteres passieren, wie ich schon mit Begriffen wie
kognitiv und emotiv angedeutet habe (vgl.Abbildung 3). Ich spreche
von IntrA-Prozessen und behaupte, sie hätten intern den
gleichen produktiv-semiotischen Charakter wie die Handlungen extern.
IntrA-Semiotik würde verweisen auf zu inferierende Referenzen
aus Wahrnehmung und Gedächtnis; auf Interpretanzen aus weiteren
Innenstrukturteilen, die wir mit Erinnern, Fühlen, Denken,
Bewerten, Wollen u.a.m. in Verbindung bringen können; und auf
darauf gründend generierte weitere Innenstrukturen, nämlich
interne Präsentanzen, die dann ihrerseits früher oder
später zu Referenten oder zu Interpretanten von weiteren IntrA-
und natürlich auch von ExtrO-Semiosen werden können. Nur
von aussen her, über externe Referenzen und Präsentanzen,
sind uns interne Referenzen und Interpretanzen
erschliessbar.
Es geht bei IntrA um im traditionell engeren
Sinn "Psychologisches". Dieses soll aber nicht vom Erleben her
angegangen werden, sondern als Inferenzen auf das zwischen
Wahrnehmungssituationen und Handlungswirkungen Unverzichtbare; denn
Intuition oder Introspektion entzieht sich der
Realitätskorrektur. Ich will das aber nicht weiter
ausführen, obwohl sich hier nicht nur ein weites, sondern auch
ein wichtiges Feld auftut.
Anmerken will ich jedoch, dass kein
Hinderungsgrund besteht, das komplexe Brain-Mind-System seinerseits
in relativ gesonderte und dennoch affine Teile separiert zu denken
und diese ihrerseits untereinander als in evolutive Dialoge
involviert zu konstruieren. Analog der Bezogenheit der IntrA-Systeme
auf die Umwelt können interne Sekundärsysteme auf
primäre Ebenen der IntrA-Strukturen aufbauen (vgl. Abbildung 3).
Es öffnen sich damit Perspektiven auf Erscheinungen wie
(1) Imagination oder
räumliches und bildliches Vorstellen: ein ikonisierendes
Zeichensystem, die Basis besonders auch der räumlichen
Orientierung;
(2) aktuell gegenwärtiges
Erleben als Brücke von Vergangenheit zu Zukunft, eine
aktualisierende Funktion: ein indexikalisierendes Zeichensystem,
die Basis besonders der zeitlichen Orientierung;
(3) innere Sprachlichkeit: ein
linearisierendes, symbolisierendes Zeichensystem, die Basis
reflexiv-abstrahierender Orientierung;
(4) ja sogar einer Konzeption des
Selbst: ein zentralisierendes Zeichensystem, die Basis von
Kohärenz und Konsistenz.
Semiotisch verstanden könnten solche
inferierte Strukturen und die sie bedingenden und tragenden Prozesse
zu integrierteren Konzeptionen der psychischen Organisation
führen, als sie bis heute üblich sind.
2.3. Semiotischer Funktionskreis unter
Einbezug der Kultur: ExtrA-Semiose
Nun kann man sich zwei oder mehr einander
affine Personen oder überhaupt Gebilde denken, welche
untereinander einen kommunikativen Konnex dergestalt eingehen,
dass des einen ExtrO-Präsentanten von den andern zur
IntrO-Referenten genommen werden. Die Idee der Verkettung von
Semiosen mit gemeinsamen Gliedern führt zu einem allgemeinen
Verständnis von Interaktion und Kommunikation, welches
ich hier nicht weiter ausführen kann. Unsere Ausgangsheuristik,
das evolutiv-dialogische Prinzip, findet auf allen Horizonten in der
Verkettung oder Vernetzung von strukturbildenden Elementarsemiosen
seine semiotische Durchführung. Analog den Einsichten der
fraktalen Geometrie ist Elementarsemiose ein Strukturbildungsprozess,
der aus seinesgleichen besteht und seinesgleichen konstituiert (vgl.
Abb.4).

Abbildung 4 "Minimale"
Kommunikation
Ich muss Sie bitten, sich anhand ihrer
semiotischen Detailkenntnisse selber auszumalen wie das in den
verschiedenen Bereichen der Realität des "sozialen Lebens"
(Saussure) vor sich gehen könnte. Denn was ich hier als
ExtrA-Semiosen konzipiere, betrifft das meiste, was Semiotiker
über den zwischenmenschlichen Umgang mit Zeichen erforschen und
aufzeigen. Ich verlagere eigentlich bloss den Akzent von der
Interpretation auf die Produktion von Zeichen und biete eine
einheitlichere und einfachere Vorstellung vom Zusammenwirken von
Zeichenhaftem mit Personen und analogen Gebilden an.
Sie werden dann freilich fragen: wozu denn
die ganze neue Redeweise? Mein Stein des Anstosses an weiten Teilen
der Semiotik ist eine Praxis der Zeichendeutung, die trotz vielerlei
Beteuerungen zum Gegenteil immer wieder der Trennung in Mentales und
Materiales verfällt: Signal und Botschaft, Zeichenträger
und -bedeutung, etc. etc. Obwohl man es anders tun kann und tut,
bieten die gewohnten Redeweisen gerade die Überwindung dieser
Dualismen nicht an. Das steht quer zu meiner Überzeugung,
Zeichenprozesse dürften Naturgesetze nicht verletzen und
könnten aber auch nicht als eine "höhere" Ergänzung
ihnen gewissermassen aufgesetzt werden. Viel besser seien unsere
Naturgesetze als "Spezialfälle" einer allgemeineren
Gesetzlichkeit evolutiver Systeme zu betrachtenden; sie beträfen
nämlich jene Bereiche, in denen der evolutive Prozess
gewissermassen zu "Gewohnheiten" erstarrt sei. Es ist in der Tat
Peirce's metaphysische Überzeugung gewesen, die Kategorie der
Zweitheit, unter welche die Naturgesetze fallen, sei in der Kategorie
der Drittheit impliziert, nicht aber umgekehrt.
Die Naturgesetze gelten im strikten
Sinn der vollständigen Erklärung eines Geschehens bloss
lokal, nämlich in abgeschlossenen Systemen, wie sie der
Experimentator herzustellen sucht. Das bedeutet, dass wenn zwei je
abgeschlossene, je für sich durchaus gesetzliche Systeme
aufeinandertreffen würden, naturgesetzliche Aussagen über
das Geschehen unsicher werden bzw. auf die Ebene statistischer
Deskription zurückfallen müssten. Nun können freilich
per Definition abgeschlossene Systeme nicht aufeinander wirken; das
Universum muss aus zueinander offenen Subsystemen bestehen. Wir
können kein allgemeines Gesetz haben, das ein evoluierendes
Universum zur Gänze erklären kann. Naturwissenschaft ist
wie alle empirische Wissenschaft zu differenzieren in deskriptive,
klassifizierende und gesetzbildende Sparten. Zu Unrecht erwarten wir,
alles Beschreibbare und Klassifizierbare entspringe zwingend
formulierbaren Gesetzen. Zu leicht verwechseln wir oft unsere
gesetzesartig formulierten deskriptiven Verallgemeinerungen mit
Gesetzen, unsere Namen mit der Wirklichkeit.
Mein Lieblingsbeispiel zur Illustration
dieses Sachverhalts ist der pyramidenförmige Berg Niesen am
Thunersee, durch Witterungs- und Schwerkraft-Wirkungen in
Zufallsprozessen quasi-historisch so geworden, wie er ist.
Naturgesetzlich in allen chemischen und physikalischen Einzelheiten,
da kein einzelner Vorgang der Ausbildung seiner Mineralien, des
Aufbaus seiner Schichten und ihrer Auffaltung oder des Absprengens
irgend einer Partikel oder irgendeines Felsbrockens jemals irgendein
Naturgesetz verletzt hat. Doch ist kein Gesetz für den ganzen
Vorgang denkbar. Denn dieser müsste ja mathematisch in einer
infiniten Formel dargestellt werden, welche den Vorgang eben
deskriptiv, also im Verhältnis eins-zu-eins abzubilden
hätte. Das wäre gerade nicht ein Gesetz, ein Typus, sondern
ein analoger Fall, ein weiteres konkretes Gebilde, freilich von
Symbolen. Dass die nomothetischen Wissenschaften Singularitäten
nicht "lieben" ist bekannt; aber warum soll uns dies davon abhalten,
deren Wirklichkeit ernst zu nehmen? Überdies erweist sich der
genannte Vorgang als ein bloss quasi-historischer: wohl verläuft
er in der Zeit einmalig, aber er zeigt keine Entwicklung in dem Sinn,
dass spätere Ereignisse frühere nicht nur voraussetzen,
sondern dass ihr Charakter von früheren her grundlegend bestimmt
ist. Gerade die Systematik von semiotiven Entwicklungen gibt uns ja
die Möglichkeit und die Aufgabe, das Reich zwischen
Notwendigkeit und Zufall begrifflich zu fassen.
Vergleichen Sie mit dem Niesen ein Beispiel
aus diesem semiotiven Bereich: Kein Naturgesetz, weder im Ganzen noch
im Detail, kann aufklären, warum Sie heute hierhergekommen sind
und mir zuhören (oder warum Sie jetzt gerade diesen Aufsatz
lesen). Und doch können Sie dabei kein Naturgesetz verletzt
haben oder verletzen. Aber es bringt halt gar nichts zu sagen, der
Geist oder Ihr Geist oder Ihr Wille oder Ihre Neugier habe Sie
hergebracht, weil Sie mir nicht erklären können, auf welche
Weise denn diese "Dinge" Massen von 50 bis 100 kg so gezielt bewegen
können. Und falls meine Elementarsemiotik wirklich etwas taugen
sollte, so enthält Ihre Begegnung mit ihr ein Potential, auch
Ihr Leben eingreifend zu verändern.
Der Unterschied zwischen dem Niesenbeispiel
und Ihrem Hierherkommen zeigt das Grundgesetz der Semiotik.
Ihr Hierherkommen beruht auf semiosischen Reihen der Interaktion von
affinen Strukturen. Nicht so die Niesen-Erosion. Der Niesen und seine
Bestandteile "weiss" nichts vom Wind und vom Wasser; seine
Oberflächen-Teile erfahren sie bloss. Die schwarzen
"Käferchen" aber in ihrem Programmheft, haben mit Hilfe von
Licht einen Weg in Ihre Augen gefunden und dann in Ihrem Sehhirn
affine Strukturen getroffen, welche in Ihren Wissensstrukturen
weitere affine Strukturen aktiviert und in Ihren
Motivationsstrukturen vielleicht Neugier und anderes geweckt haben.
Oder ähnlich die Schallwellen der
Mund-zu-Ohr-zu-Mund-zu-Ohr-Semioseketten. Und so weiter.
Alles ging mit rechten Dingen, also auch,
aber nicht allein naturgesetzlich zu. Denn immer wenn diese
schall- und lichtgetragenen Wirkgebilde im Zusammentreffen mit den
ihnen affinen neuronalen und humoralen Strukturen in Ihrem Brain-Mind
zusammengetroffen sind, haben zwar jede Menge unentbehrlicher
stofflich-energetischer Umsetzungen stattgefunden und haben bei Ihren
Gefühlen, Gedanken, Erwägungen, Entscheidungen, Handlungen
eine unverzichtbare Rolle gespielt. Doch kam es auf das strukturelle
Muster dieser gesamten Prozesse in Relation zu anderen Mustern in
Ihrem Mind-Brain an. Ferner sind hinterlassene Spuren von
früheren Geschehnissen ähnlicher Art in das Muster
eingegangen. Und alle diese internen und externen Strukturen und
deren Interaktion sind weder objektiv noch subjektiv, wohl aber
semiotiv zu begreifen, weil sie ihre Eigenart in echter, konkreter
Geschichte gewonnen haben. Die Naturwissenschaften in strengen Sinn
haben aber für die Folgen von Geschichte keine eigenen Begriffe.
So denke ich, zeichenhaft oder semiotiv könne man allgemein
Strukturen nennen, insofern sie in geeigneten Umständen
Wirkungen haben können, welche sie als solche bzw. in anderen
Umständen nicht haben.
2.4. Das Semion als Basis der logischen
und strukturellen Ordnung der Semiose
Nun habe ich mancherlei von der produktiven
Semiose als Prozess dargestellt. Ich verstehe diese ExtrO-, ExtrA-,
IntrO- und IntrA-Phasen des Funktionskreis als mit unterschiedlichen
konkreten Strukturen, aber dennoch in gleicher Weise vollzogene
konstitutive Prozesse und bezeichne sie als Elementarsemiosen.
Damit meine ich nicht, dass sie elementar im Sinne von in sich
abgeschlossen seien, sondern einfach im Sinne von analytischen
Grundprozessen, auf die man alle Phänomene des Umgangs mit
Zeichen zurückführen kann. Das Interessante an dieser
Konzeption dürfte sein, dass so verschiedenartig Erscheinendes
aus einem einzigen und einfachen und realen Grundprozess heraus
verstanden werden kann.
Es ist leicht vorzustellen, dass semiosische
Prozesse im Funktionskreis jedes Lebenwesens auf verschiedenen Ebenen
oder Horizonten spielen können. Davon sind die die elementarsten
wohl auf molekularer und zellularer Ebene anzusiedeln; die
komplexesten auf einer Lebenslaufebene und im kulturellen Bereich
darüber hinaus anzusiedeln. Denn die Art, wie grosse
Moleküle interagieren, zB in Vorgängen wie der
Proteinsynthese, ist ebenso triadischen Charakters wie die Generation
von Nachkommen oder historischen Hinterlassenschaften. Je elementarer
die Ebene, desto deutlicher werden wir auf reale Vorgänge
bezugnehmen können, je komplexer die Zusammenhänge, desto
stärker nominalen Charaker, dh durch unsere Konzeption der
Vorgänge mitbestimmt, wird unser Verständnis sein. Der
Zusammengesetzheit der Semiosen parallel kann ihre zeitliche
Erstreckung kleiner oder grösser sein. Die Rolle der Forscher
und ihrer Verfahren ist bei Konzeption und Untersuchung umso
grösser, je höher der Horizont. Empfehlenswert ist die
methodische Maxime, wenn immer möglich zwei oder mehr Horizonte
zu rekonstruieren, bevorzugt in voneinander unabhängigen
Darstellungsformen.
Es sollte nebenbei klar geworden sein, dass
Forscher nichts anderes tun, als mit ihren observativen,
begrifflichen und methodischen Interpretanzen -- manchmal unter
Zwischenschalten von apparativen Interpretanzen -- gewisse Referenzen
aus ihrem Forschungsfeld in solche Präsentanzen in ihrem
Brain-Mind umzusetzen, dass sie später dann etwas davon,
"verhackt" und neu "verwurstet", ihren wissenschaftlichen Kollegen
und der Allgemeinheit in Buch- oder Vortragsform präsentieren
können. Diese werden hoffentlich ihrerseits sinnvolle
Interpretanzen anlegen, um ihre "Auszüge" von davon in ihr
Mind-Brain zu "packen" und anders wieder "auszulegen". Die meisten
dieser Metaphern lassen sich erstaunlich wörtlich
nehmen.
Neben dem damit angesprochenen Prozessaspekt
ist schliesslich noch die Form der Semiose als Struktur auf
ihren verschiedenen Horizonten nachvollziehbar zu machen. Auf allen
Zeit- und Strukturhorizonten können Referenzen, Interpretanzen
und Presentanzen als Triaden auch unter Abstraktion vom Prozess in
der Zeit konzipiert und beobachtet oder erschlossen werden. Ich
spreche von semiosischen Strukturen als Semionen, weil jede
solche Struktur wie das chemische Ion ein zwar strukturelles Gebilde
ist, seine Haupteigenschaften aber darin bestehen, dass es mit
affinen Semionen gewisse, keineswegs beliebige, aber ebensowenig
eindeutig festgelegte Bindungen eingehen kann. Natürlich werden
diese Bindungen in der Zeit als Semiosen vollzogen.
Semionen sind also zugleich Bausteine und
Bindekräfte von allem, was nicht zu dyadisch-reaktiven
Gewohnheiten degeneriert ist. Peirce's These vom Menschen als
Zeichen (unter Einschluss der sozialen Systemen und sonst noch
allerlei mehr) würde dann auf Semionen zu beziehen sein, als
zeitabstrakte Gebilde, deren Leistung gerade darin besteht
Zeitintervalle jeglicher Art zu überspannen. Sind Semiosen
Darstellungen des evolutiven Dialogs mit dem Akzent auf der
möglichen Innovation, so fassen Semionen das stabilisierende
Moment. Als dynamisches "Gedächtnis" können sie in einem
ihnen affinen Milieu jederzeit wieder in evolutive Dialoge eingehen
und in neuen Semiosen die Modifikation von oder die Bildung neuer
Semionen mitbedingen, indem sie ihre Geschichte zur Wirkung
bringen.
Auch Wohnungen und andere kulturelle
Gegenstände oder Systeme sind in diesem Sinne als Semionen zu
konzeptualisieren. Sie wurden von Menschen in Semiosen
zusammengetragen (das stehe stellvertretend für:
in Traditionen hergestellt, ausgewählt, angeordnet, abgewandelt
...) und bereiten für Menschen, die gleichen und andere
über die Generationen, ein Bindebett von Angeboten, das die
Bewohner mehr oder weniger wirksam zusammenhält. Hans und Silvia
zusammen mit ihrem Haus bilden ihrerseits wieder so ein offenes
Semion mit allerlei Potentialen für weitere Anbindungen für
Kinder, Freunde, Handlungsweisen, Ideen u.v.a.m. Auch was ich
früher unter dem Stichwort der Enkulturation angedeutet habe,
lässt sich unter dem strukturellen Aspekt leicht
weiterdenken.
Inhalt
3.
Semiosen als Zeitmacher
Ein kleiner Vergleich zwischen verschiedenen
Auffassungen von Semiotik (vgl. Lang 1993b und 1993c) kann vielleicht
in die Problematik von Zeichen und Zeit einführen.
Versteht man die Semiotik als die
Untersuchung von Zeichenobjekten oder
Zeichenbedeutungen, so ist die Rolle der Zeichen in Bezug auf
die Zeit eine abstrahierende. Immerhin kann, was früher Zeichen
geworden ist, heute oder morgen seine alte oder neue Bedeutungen
entfalten. Damit ist der Pfeil der Zeit, ihre Gerichtetheit,
konstitutiert; denn kein Zeichen kann rückwärts wirken.
Dieser Vorzug der älteren Zeichenlehren
entfällt jedoch in einer Semiotik, die sich als
Kommunikationswissenschaft versteht. Denn das
informationsübermittelnde Zeichen im Kanal zwischen Sender und
Empänger ist zeitlos; braucht Kommunikation Zeit, dann liegt das
nicht am Zeichen, sondern am Kanal.
Auch die hier vorgebrachte Semiotik als
triadisch-generativer Bedingungs-Wirkungs-Zusammenhang zwischen
Strukturen scheint auf den ersten Blick von der Zeit zu
abstrahieren. Genauer gesehen bringt sie jedoch den Vorzug, den
Wechsel zwischen Struktur (unter Abstraktion von Zeit) und Prozess
(den evolutiven Fluss) in den Brennpunkt zu nehmen.
Im Folgenden kann ich nur drei Streiflichter
auf Zeit in der generativen Semiotik werfen. Ich möchte hier
zwei Forschungsfelder aufnehmen. Das erste habe ich vor über 20
Jahren im Rahmen meiner Habilitation beackert: Die multiple innere
Uhr: ein Beitrag zur Psychologie der Zeitwahrnehmung und des
Zeitverhaltens (Lang 1971, vgl. Lang 1973; 1997). Das zweite
betrifft ebenfalls in die 70er Jahre zurückreichende
Untersuchungen zur Gehörswahrnehmung, insbesondere zum
sogenannten Absoluthören und zur Klangkonstanz (vgl. Lang
1993d). Mit Hilfe der Elementarsemiotik, so glaube ich, lassen sich
die dort entwickelten Ideen begrifflich fruchtbarer fassen und in
neue Untersuchungsweisen umsetzen. Wichtiger aber scheint, mir, dass
generative Semiotik den zeitlichen Fluss von Evolutionen ins Zentrum
stellt.
3.1. Eigene und affine
Zeit
Schon bei der Einführung des
Funktionskreises habe ich im Anschluss an von Uexküll die
Eigenständigkeit komplexer semiosischer Strukturen, also von
Semionen betont. Die Evolutionsbiologie wird sich, wie einige ihrer
Vorkämpfer bereits kundtun (zB Mayr 1991), daran gewöhnen
müssen, neben dem Anpassungsprinzip ein gleichwertiges
Autonomieprinzip für Lebewesen zu akzeptieren. Lebende
Systeme sind eigene Gebilde, von den physiko-chemischen
Gleichgewichten ihrer Umgebung relativ entfernt, in gewisser Hinsicht
in ihren eigenen semiotiven Gleichgewichten befindlich, was
bedingt und ihnen erlaubt, ihr internes physiko-chemisches
Gleichgewicht in gewissen Grenzen zu steuern und gegen das
physiko-chemische Geschehen ihrer Umgebung relativ gepuffert, bloss
selektiv angeschlossen zu sein.
Eine interessante Manifestation davon ist,
dass Lebewesen ihre eigene Zeit machen oder
herstellen; eine zweite, dass sie die ihnen aus der Umgebung
angebotenen Zeitstrukturen auf ihre eigene Weise umsetzen und nutzen
können.
Doch könnten lebende Gebilde nicht
bestehen, wenn sie ihre eigene Zeit (wie auch die meisten anderen
ihrer Charaktere) nicht mit der Zeit ihrer Umgebung zu koordinieren
vermöchten. Sie müssen, wie wir gesehen haben, nicht nur
eigene, sondern auch zu ihrer Umwelt affine Innen-Strukturen bilden.
Gerade solche Strukturen sind sie ja selber.
Die Konstitution von eigner und
koordinierter Zeit ist heute chronobiologisch einigermassen klar.
Das Zusammenspiel von internen metabolisch-physiologischen
Oszillatoren und Integratoren unterschiedlichster Frequenzen, die man
in allen Teilen des Körpers findet, und den sogenannten externen
"Zeitgebern", wie allen voran dem Tag-und-Nacht-Wechsel aber auch
weiteren lunar und solar oder auch sozial bestimmten "Uhren", ist
relativ gut untersucht. Macht man die externen Zeitgeber oder Uhren
unwirksam, wie etwa beim Leben unter Tag ohne jede Uhr, laufen die
internen Zeitmacher (ich bezeichne sie provokativ so, denn sie
sind genau das) allein nach ihren eigenen art- und
organismus-spezifischen Frequenzen. Der diurnale Zyklus bei Menschen
etwa verlängert sich meist etwa auf Perioden um 25 und mehr
Stunden.
3.2. Die Multiple innere Uhr als
semiotive Synthese
Soweit ist vielleicht ohne Semiotik
auszukommen. Aber warum sind diese internen Zeitgeber, warum ist
unsere innere Uhr, so erstaunlich stabil? Müsste sie nicht jedem
momentanen "Wind" von irgendwoher unterliegen? Müssten nicht
beispielweise erhöhte Körpertemperatur, ein Fieber, die
organismischen Oszillatoren beschleunigen und damit unser
Zeitverhalten beschleunigen, Unterkühlung sie verlangsamen? Wie
kann ein Dirigent in Stunden höchster künstlerischer
Erregung und extremer körperlicher Anspannung sein konzipiertes
Tempo und seine subtilen Tempowechsel einhalten? Wie kann anderseits
unser Zeiterleben so erratisch wild laufen, wenn uns Stunden als
Minuten und umgekehrt erscheinen? Machen wirklich erst mechanische
oder elektronische Uhren unser Zeitverhalten
verlässlich?
Wie die kalender- und uhrenlosen Zeitsinne
der Tiere und unsere eigenen kognitionsbefreiten Zeit-Leistungen
zeigen (gezielt Aufwachen ohne Wecker kann man lernen), ist dem nicht
so.
Ich konnte in einfachen Experimenten (Lang
1973, 1997) wahrscheinlicher machen, dass die innere Uhr gewissen
Beeinflussungsversuchen in erstaunlichem Masse widerstehen kann. Sie
weist Konstanz auf oder kann als metastabil bezeichnet werden. Und um
das verständlich zu machen, entwickelte ich ein (damals bloss
funktionales) Modell der multiplen inneren Uhr, wonach
mehrere, als solche durchaus selbständige Oszillatoren, sofern
sie "dialogisieren" d.h. sich gegenseitig beeinflussen können
bzw. durch eine gemeinsame Darstellung wirken können.
Ähnliche Modelle sind in der Zwischenzeit von andern Forschern
(zB Jürgen Aschoff) erwogen und vorgeschlagen worden.
Um das illustrativ zu erschliessen, verweise
ich auf Ergebnisse aus jenen Experimenten, in denen Personen
ineinander verschachtelte Zeitproduktionen machten. Sie sollten 4, 5,
6 oder 7 Minuten lang Bilder in kurze Intervalle kodieren. Die Bilder
zeigten zB eine Zufallsanordnung von 15 bis 50 Reiskörnern, also
zu viele zum Zählen. Die Personen sollten jedes Bild einen
Augenblick, aber umso länger anschauen, je mehr Körner
darauf waren. Per Knopfdruck gaben sie sich in Abständen von
wenigen Sekunden das nächste Bild. Und das vier etc. Minuten
lang, gemäss ihrer eigenen inneren Uhr.
Bei zufälliger Abfolge der Bilder wurde
die Wahrscheinlichkeitsverteilung der dargebotenen Reiskornzahlen
variiert. Das Ziel der Versuche war, die Korrespondenz zu beleuchten,
die zwischen unterschiedlichen internen Zeitgebern besteht: zwischen
rascheren (die freigewählten Periodenlängen von ein paar
Sekunden müssten ihnen näher sein) und etwas länger
erstreckten Zeitgebern (der Abbruch der Tätigkeit nach subjektiv
abgelaufenen vier etc. Minuten müsste dies
darstellen).
Die Ergebnisse legten nahe, dass solche
unterschiedlichen Zeitgeber zusammengenommen Systemcharakter
aufweisen. Dh, wenn man einen beeinflusst, bleiben die andern bis zu
einem gewissen Grad unbehelligt und die längeren
Schätzungen sind meistens nicht betroffen; bei stärkerem
Wechsel eines kurzen kann es aber zu einer Art Umspringen des ganzen
Systems der kurzen in eine andere Stabil-Lage kommen und dann
können auch die Minuten-Schätzungen mitgehen bzw. eine
veränderte Dauer bekommen.
Dabei blieb ich damals stehen. Heute kann
ich elementarsemiotisch erwägen, dass solche internen und
externen Oszillatoren in der Rolle von Interpretanten einander
semiosisch zur Referenten nehmen und in neue und eigene
"Oszillatoren" oder Zeitmacher, interne und externe, umsetzen. Solche
intern und extern koordiniert operierenden Systeme müssten
sowohl der idealisierenden Konzeption von Uhren wie auch dem
verallgemeinerten "inneren Zeitsinn" zugrundeliegen. Es wird reizvoll
sein, mit dieser Heuristik ausgewählte Koppelungen empirisch zu
untersuchen. Zeitmacher bilden so gesehen viel reichere,
wechselseitig sich bedingende Netze und stehen sich nicht mehr nur
als externe taktende Zeitgeber und intern getaktete Zeitnehmer
gegenüber.
Weiter lässt sich diese Vorstellung
unter Rückgriff auf das oben über Semiose und Naturgesetz
Gesagte konkretisieren bezüglich der Art und Weise, wie die
"Uhren" von Lebewesen und Sozialsystemen semiotiv konstituiert sind.
Was hier "Zeitmacher" genannt worden ist, verbirgt eine allgemeine
Vorstellung der Tatsache, dasss Semiosen als Prozesse gar nicht
anders als zeitlich sein können. In sich selbst betrachtet
stellt Semiose Zeit her, insofern der Prozess vom Referenten
über den Interpretanten zum Präsentanten nicht ein
unmittelbarer ist sondern die Interaktion von stofflich-energetisch
formierten Strukturen bedingt.
Von aussen her betrachtet, auf eine Menge
von Semiosen bezogen, ist die Bezugnahme von semiosischen Komponenten
aufeinander mit Restriktionen belastet. Ein Präsentant kann von
einem Interpretaten nicht zum Referenten genommen werden, bevor er
nicht konstituiert ist. Im Verhältnis zueinander konstituieren
also viele Semiosen in einem System automatisch ein System des Vor-
und Nacheinander. Dessen semiotive Systematisierung ist nichts
anderes als Zeit.
Zeitgeber müssen durchaus nicht
notwendig periodisch schwingen und einem Zählverfahren
unterworfen sein, sondern jeder konkrete semiosische Vorgang ist ein
Zeitmacher und zugleich ein Zeitnehmer von andern und ein Zeitgeber
für andere Semiosen.
Eigendauer scheint demnach auf einer
stabilisierenden Synthese aus unterschiedlichen internen und externen
Zeitgebern zu beruhen. Aus vielen Referenzen entsteht, wohl nach
vielerlei Zwischengliedern, ein verhältnismässig
einheitlicher, kohärenter, linearisierender Präsentant,
beispielsweise in der Form von Zeit, die Routinen steuert und die
variabel erlebt oder als isotroper eindimensionaler Vektor gedacht
wird. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Vorstellung von Zeit,
welche in allen ihren Manifestationen von einem hierarchisch
höchsten letzten Zeitgeber (bei Newton die absolute Zeit)
bestimmt gedacht wird, geht in dieser Vorstellung ein "Gewimmel" von
vielen, untereinander in Interaktion tretenden Zeitmachern der
Möglichkeit voraus, dass eine Menge solcher
synthetisierend zusammengefasst und für gewisse Zwecke praktisch
dargestellt als nützliche Uhr verwendet werden
können.
3.3. Hörphänomene:
dimensionale Vielfalt aus linearem Schwingen
Ein auf den ersten Blick völlig
verschiedenes, der Funktionsweise nach jedoch analoges Feld von
zeitlichen Ereignissen von eher rascherer Varietät existiert in
einem "Gewimmel" von Dauern und Ereignisrelationen im Vor- und
Nacheinander, welche wir uns selber und einander sprechend, singend,
musizierend usw. anbieten: Vibrationen, welche das Ohr aufnehmen und
semiosisch umsetzen kann. Im Hörsystem finden wir -- bei
näherem Zusehen und befreit vom kartesianischen Weltbild mit
seiner Einheit des Bewusstseins -- gerade andersherum als bei der
inneren Uhr eine Aufspaltung eines einheitlich-linearen Referenten
durch unterschiedliche Interpretanten zu einer Vielzahl und Vielfalt
von unterschiedlichen Präsentanten, nämlich den
verschiedenen Qualitäten eines Hörereignisses.
Es ist bekannt, dass das Trommelfell unter
Wirkung von Schall einheitlich schwingt, als eine lineare Folge von
stärkerem oder schwächeren Hin und Her. Wir können das
analysieren, einerseits als ein reales lineares Geschehen in der Zeit
und das Ergebnis etwa als Schalldruckkurve in Funktion der Zeit
darstellen. Anderseits können wir fourieranalytisch (zB in Form
eines Spektrogramms) zeigen, dass der real einheitliche Fluss logisch
eine Mischung von vielerlei je gleichartigen Gebilden darstellt,
nämlich eine Summe von Anteilen von verschiedenen Frequenzen,
wie sie durch das Schwingverhalten von Körpern oder Gruppen von
schwingenden Körpern erzeugt werden. In der Musik bilden wir
durch schwingende Saiten oder Luftsäulen wohlgeordnete Muster;
in Geräuschen sind die Mischungen eher erratisch; Sprechsprache
erzeugt wiederum zeitlich gut geregelte Kombinate von beidem.
Das Ohr scheint, nach der herrschenden
Theorie, etwas irgendwie Ähnliches wie die Frequenzanalyse zu
leisten und sich damit angeblich ein Abbild der objektiven
Wirklichkeit zu gewinnen. Aber wir hören Musik und Sprache:
Tonhöhen, Melodien, Akkorde, Harmonien, Grund- und
Leittöne, Takt, Rhythmen, Artikulation, Klangfarben, Gesang,
Vokaltyp, Silben, Wörter, Sätze, usf.; nicht
Frequenzgruppen und dergleichen. Der Instrumentenbau der
Musiktraditionen, die Stimmpflege, die Klassifikation von
Schällen, ja sogar unser Umgang mit (nicht so sehr die
Konstruktion von) schallerzeugender Elektronik beruht zunächst
auf diesem subjektiv Gehörten und nicht auf physikalischen
Schallbeschreibungen. Ja wir hören sogar freundlichen Zuspruch,
gehässigen Angriff, eine individuelle Person, deren Freude oder
Traurigkeit u.a.m. Analysen unseres Umgangs mit Schall zeigen, dass
Unterschiede und Ähnlichkeiten in solchen
Eigenschaftsdimensionen das Eigenartige des Gehörten
ausmachen. Dieses Eigenartige mag subjektiv sein in dem Sinne,
dass jeder einzelne Mensch nur seine eigenen Hörphänomene
wirklich hat; nicht jedoch in dem Sinne, dass Klangfarben, Harmonien,
Spannungslösungen, Wiedererkennen einer Stimme einzig der
Willkür der Hörenden entsprängen. Die wissenschaftlich
postulierte Trennung zwischen dem "objektiven" Schall und dem
"subjektiven" Klang löst sich auf, sobald wir den Vorgang des
Hörens semiotiv begreifen und damit verstehen können, dass
Zeitstrukturen, in geeigneter Weise semiosisch prozessiert, in ein
reiches Feld von Charakteren Darstellungen finden können, wie
sie unser Musikhören vollbringt.
Der hier aufgezeigte Unterschied zwischen
zwei Verständnis- und Forschungsstrategien scheint mir
exemplarisch. Im kartesianischen Weltbild gelten gewisse Charaktere
der objektiven Welt als gegeben; die subjektive Welt habe sich dann
in Anpassung dazu herausgebildet, die Wahrnehmung bilde demnach die
Welt in die Subjekte ab, allenfalls mit Einbussen durch gewisse
Verzerrungen. Anderseits wird die Fähigkeit der Subjekte zu fast
beliebiger Konstruktion von Welt hochgehalten, sei es real im
Fortschrittsglauben, sei es beschränkt auf die symbolische Welt
der Sprachen.
Eine evolutiv-dialogische oder semiotive
Sicht des Relationensystems Mensch-Kultur könnte nicht nur das
Schwanken zwischen diesen beiden widersprüchlichen Sichten
vermeiden helfen; es würde auch die Teilsysteme in wechselweise
Bedingtheit stellen und neue Grenzen ihrer Fixierungen und
Wandlungspotentiale aufweisen. Musiktraditionen sind besonders
fruchtbare Felder zum Studium semiotiver Systeme. Die Pflege
generativer Praxis und deren Verkörperung im Instrumentenbau in
ExtrA-Prozessen ist über Jahrhunderte recht gut dokumentiert und
bildet ihrerseits die Basis von IntrA-Prozessen der Verfeinerung und
Spezifizierung bestimmter Hör- und Musizierweisen in den
Kulturen der Welt (vgl. Boesch 1993).
Elementarsemiotik scheint sich nicht zuletzt
als Heuristik zu eignen, weil sie dazu auffordert, in dem sukzessiven
Wechselspiel in Funktionskreisen auf individueller und auf
kultureller Ebene nach Referenzen und Interpretanzen zu suchen und zu
zeigen, in was für Präsentanten die jeweiligen Umsetzungen
erfolgen.
3.4. Eine semiotiv-ökologische
Sicht der Zeit
Oh Herr, gib jedem seinen eignen
Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben
geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.
Meine semiotischen Erwägungen über
Zeit lassen sich anhand einer evoluierenden Variante von Rainer Maria
Rilke's berühmtem Gebet aus dem Stundenbuch von 1903
elaborieren:
Oh Herr, gib jedem seine eigne
Zeit ...
Natürlich geht auch Rilke davon aus,
dass eigentlich jeder nur seinen Tod sterben kann, und so können
wir selbstverständlich auch nur jeder und jede unsere eigene
Zeit leben. Doch Rilke scheint nach so etwas wie dem "Subjekt" des
Sterbens zu fragen, und damit nach dem "Subjekt" des "eigenen"
Lebens, das dem "eigenen" Sterben vorausgeht: also, was es denn nun
sei, das Sterbende oder das Lebende, und ob das aus einem selbst
stamme oder anderswoher, ob das eigen sei oder eigen zu machen sei.
Der abgenutzte und vieldeutige Ausdruck "Subjekt" trägt freilich
kaum, was da angesprochen ist. Rilke kostet diese Spannung zwischen
dem Individuellen und dem Kollektiven des Sterbens bis zum letzten
aus. Sein Wünschen, so darf man allerdings vermuten, bevorzugt
jeder individuellen Person eigenes Leben und eigenen Tod; dies
angesichts einer Gesellschaft, die den Kult des Individuums immer
höher schraubt, um umso leichter die Anonymität des
mobilen, konformen, erpressbaren, ausbeutbaren, ... sogenannten
Individuums zu nutzen.
Spielen wir ein Gedankenexperiment mit der
eigenen Zeit!
Wir machen und leben in der Tat unsere
"eigene" Zeit. Freilich mit Hilfe von "fremden" Prozessen der Natur
in uns und um uns. Die genutzten Prozesse reichen vom Lauf der
Gestirne über die molekularen und neuronalen und hormonalen und
muskulären Oszillatoren in unseren Organismen bis zu den
mittelbaren kulturalen Zeitgebern der Uhren, der Arbeits- und
Mahlzeits- und Geselligkeitspläne, nicht zu vergessen die
eigenen Zeiten der unmittelbaren Anderen im gemeinsamen Handeln.
Menschliches Leben und Zusammenleben ist
undenkbar ohne dass Zeit über natürliche und kulturelle
Prozesse sozial koordiniert wird. Ich brauche nur an die
bedauernswerten Schichtarbeiter zu erinnern, von denen wir zur
Aufrechterhaltung sozialer Beziehungssysteme, an denen sie dann aus
Zeitgründen nicht teilnehmen können, fast unmenschliche
Sonderanstrengungen abverlangen.
Aber wehe wenn die Zeit kulturell total
koordiniert wird! Da will ich an die Dummheit im Umgang mit der Zeit
in unseren Schulsystemen erinnern, einschliesslich der verschulten
Universität, deren Stunden- und Normstudienpläne es wirksam
erschweren, dass lernende Menschen hinter die Oberflächen der
Dinge tauchen.
Ich wollte das nur kurz andeuten und auf dem
Hintergrund einer semiotiven Sicht der Welt in den Vorschlag
verdichten, den abgewandelten Rilke-Satz nach allerhand Erfahrung mit
Individualisierungs-Exzessen evolutiv-dialogisch im gesamten
Lebenszusammenhang noch einmal zu erneuern und vielleicht zu
beten:
Oh Herr, gib uns gemeinsame
Zeit, und jedem,
dass er darin nehmend und gebend
auf seine eigene Weise schwingen
möge!
Inhalt
Eine
Art Zusammenfassung
Die heute vorherrschenden kommunikationstheoretisch angelegten
Semiosemodelle haben den Nachteil, dass sie ihre Bestandteile
(Empfänger, Medium, Botschaft, Sender, etc.) voraussetzen,
obwohl diese selber erklärungsbedürftig sind und vielleicht
mit Vorteil gerade auch semiotisch begriffen werden sollten und
könnten. Ebenso setzt diese Auffassung Raum und Zeit als
Rahmenbedingungen von Semiose einfach voraus.
Kommunikationstheoretisch-semiotisch ist Zeit belanglos; es sind
bloss die materiellen Vorgänge im kommunikativen Kanal, welche
Zeit "brauchen" und über Raum "transportieren". Alle heute
üblichen Zeichen- und Bedeutungsbegriffe abstrahieren
weitgehend von Zeit und Raum; man untersucht bestenfalls deren
Diachronie oder Zeit als Signifikator. Allenfalls begründen
herkömmliche Zeichenbegriffe, insofern kein Zeichen in seine
Vergangenheit wirken kann, implizit die (ordinale) Gerichtetheit von
Zeit, nicht aber ihre "Dichte" oder ihren "Fluss".
Das alles ist wenig befriedigend angesichts der Tatsache, dass
Lebewesen in einem so erstaunlichen Ausmass ihre je eigenen und mehr
als ordinalen Zeit- und Raumsysteme konstituieren und diese
untereinander und mit vorgegebenen umweltlichen Bedingungen und
kosmisch bestimmten Ereignisreihen wie Jahreszyklen oder
Tag-Nacht-Wechsel und ihren Folgen zu koordinieren
vermögen. Es ist sogar geradezu bestürzend im Hinblick
auf den Umstand, dass Zeichenhaftes recht eigentlich die zentrale
Rolle in allen evolutiven Prozessen spielen muss. Denn jede Evolution
setzt voraus, dass etwas, was zu einer Zeit entsteht, zu einer
späteren Zeit wiederum eine Rolle spielt. Das kann jedoch nicht
das damals Entstandene selbst, sondern muss zwingenderweise eine
Darstellung davon sein. Als Beispiele dienen hier das Verhältnis
vom Genom zum Organismus in der Bioevolution oder die Wirkung einer
in Historie gefassten Darstellung früherer Erfahrung im
kulturellen Wandel
Angesichts solcher Feststellungen dürfte es angezeigt sein,
eine Konzeption von Semiotik herauszubilden, welche genuin zeitlichen
Charakter aufweist. Wird der Zeichenprozess aus seiner Befangenheit
im Deutungszusammenhang befreit, indem man Peirce's Idee aufnimmt,
jede Deutung eines Zeichens müsse im Schaffen eines weiteren
Zeichens bestehen, so muss unsere Aufmerksamkeit bevorzugt dem
Generieren von Zeichen anstatt der Interpretation vorbestehender
Zeichen gelten. In dieser Perspektive werden eine elementare
Konzeption der Semiose und der neue Begriff des Semions
vorgeschlagen, welche den generativen Charakter von Zeichenprozessen
und Zeichenwelten in den Mittelpunkt stellen. Damit ist eine
Möglichkeit gewonnen, Struktur und Dynamik nicht als
getrennt und additiv, nicht als passiv-objekthaft bzw.
aktiv-subjekthaft, sondern wie in den Energie- und
Stoff-Wissenschaften als zwei Aspekte ein und derselben Wirklichkeit
zu begreifen.
Es wird also hier ein Umgang mit Zeichenhaftem vorgeschlagen,
welcher nicht wie üblich einen alltagssprachlichen
Gegenstandsbereich begrifflich zu systematieren versucht (und sich
damit freiwillig einschliesst), sondern als zeichenhaft jenes
bestimmt, was zwischen zwei Erscheinungen vermittelt, wenn eine
direkte und notwendige Bedingungs-Wirkungskette nicht ausreicht.
Es zeigt sich, dass ein so konzipierter Zeichenprozesses eine
konstitutive Rolle für Zeit spielt und dass überdies
dieser zeitliche Charakter der Semiose als ausschlaggebend für
die Möglichkeit von Evolution überhaupt wird.
Semiose wird im Anschluss an Peirces triadisches Denken als ein
allgemeines Verursachungs- oder Bedingungs-Wirkungskonzept
verstanden. Zeichenhaft seien alle Entitäten, welche als
dritte aus der Begegnung von zwei anderen (zeichenhaften)
Entitäten hervorgehen und ihrerseits solche Wechselwirkungen
eingehen und damit neue Zeichen generieren können. Der
Begriff der elementaren Semiose stellt diese Dreifachrelation
als Prozess, der Begriff des Semions als den logischen
Wirkungszusammenhang von mehr oder weniger überdauernden
Strukturen dar, welche der Aufbewahrung eines Wirkungspotentials
über die Zeit und seiner Transportierbarkeit im Raum dienen
können. Diese generative oder Semion-Semiotik konstituiert
mithin gerichtete und zunächst ordinale Zeitlichkeit und sie
vermag die Gegenwart als Scheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft
zu erklären Wendet man diese Vorstellung auf oszillierende
Strukturen und andere Entitäten an, welche intrinsisch-reaktive
Zustandswechsel durchlaufen, so ist überdies ein semiotisches
Konstituens von biotischer, psychischer und kultureller Zeit im
Sinne von Periodizität wie von erstreckter Dauer und der
Differenzierung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
gefunden.
Inhalt
A Kind of
Summary
This paper (a slightly edited version of a 1993 presentation)
presents essentials of a generative form of semiotic and applies it
to questions of the constitution and analysis of time. By emphysizing
the generative rather then the interpretative aspect of semiosis it
attempts to improve the practicability of Charles Peirce's
triadic-semeiotic thinking and his Thirdness category. By including
the conservating and the generalizing potentials of semiosic
structures (called semions) it aspires at an universal conception of
mediated causation or condition-effect-connection which pertains to
all phenomena of evolutive change. This form of semiotic, in
particular, is apt to describe the becoming, the change and the
dissolution of:
• organic or organismic systems in their continuing
exchange with their environment (phylogenesis, bioevolution);
• learning individual organisms in their experience
dependant life course within their world, in humans in particular
of persons in their culture (ontogenesis, individual
evolution);
• social systems or groups of all kinds in their waxing
and waning within their milieu, in humans in particular of
cultures and their diversification (cultural change, cultural
evolution).
Development or evolution is to mean that systematic, yet both
diverging and converging, i.e. regular and at the same time
contingent, change of a system with its framing system; when viewed
retrospectively change proves to be historically singular and thus it
emerges prospectively open. In contradistinction to the time
conception of physical science, evolutive systems are genuinely
temporal; for evolution of any concrete system, in every present
moment, "cristallizes" one only out of its many possible futures into
its unique real past (see Lang 1997).
There exist surprising structural commonalities on the said three
orders of evolution and in spite of their diverse manifestations. If
semiotic is to be among other things a general procedure for
comparison of different sciences, then it should exactly prove
capable in probing commonalities between various developing systems.
For this we need:
• a general concept of semiosis in
process-perspective, and founding change;
• a corresponding concept of structure (called the semion)
in state-perspective, and providing for memory or conservation of
something for later use;
• both of which are then brought into a common perspective
of reciprocating process and structure which can constitute
evolution and time,
So part (I) will be dedicated to unfolding semiotic ecology from
the content side. The leading idea here is the ecological function
circle, i.e. the semiosic interchange of concrete living beings and
similar systems with their environment with the effect of mutual
transformation. In part (II) the conception of the elementary
semiosic units in process (triadic semiosis) and state view (the
semion) and their intercourse are presented. Reference to Peirce is
made and a decisive distinction allowing for the generative character
of semiosis is pointed out. Part (III) particularizes semiotic
ecology in view of the constitution and analysis of time in evolutive
systems. This is one of many examples demonstrating the heuristic
efficacy of generative semiotic in conjunction with the ecological
function circle. Usually, we say development to happen "in" time and
therewith presuppose time to exist independently. The idea that any
developing system produces its propers time by its very process
though finds increasing support. Semiotic concretization of this idea
may lead to better understanding of time.
The following line of argumentation may give an idea of the the
kind of problem and solution embarked upon by semiotic ecology in the
present context.
Presentday models of semiosis are dominantly of a communication
theoretical character and thus suffer from the fact that their
component parts (receiver, medium, message, sender, etc.) must be
presupposed in spite of being themselves in need of being explained.
Perhaps those might best be conceived of in semiotic terms rather
than being taken over metaphorically from technical devices. In a
second and independent prerequisite, this common conception also
simply presupposes space and time as a framework of semiosis.
However, in communcation-theory semiotics time is of no avail; it is
only the material events in the communication channel which "take"
some time to run and "transport" over space. All of today's concepts
of sign or of meaning abstract thoroughly of time and space. At most,
diachrony or change over time of sign system or sign use is
investigated. The only factual temporal implication of sign concepts
is their (ordinal) directedness in time, in that no sign can effect
upon its past; but they do not respect neither "flow" nor "density"
of time. Nominally, the tempora of linguistic signs relate to time;
they deeply contradict scientific time conceptions.
All of this is less than satisfying in view of the fact that
living beings to such an astonishing extent constitute their proper
time and space systems that are more than ordinal and that are so
highly coordinated among each other and with environmental conditions
such as yearly, lunar, or diurnal oscillations and their consequnces.
It is even utterly disturbing in view of the estimation that sign
processes may or must play an absolutely central role in all
evolutive ongoings. For any evolution requires something which arises
at one time can play again a role at a later time. Yet this cannot
necessarily be that something itself, but will often be some
representation thereof. For an example the relation between the genom
and the organism in bioevlution may be considered, or the
representation in history of some earlier experience which can
influence cultural change.
Such insights definitely suggest the development of a conception
of semiotic of genuinely temporal nature. If the sign process is
emancipated from its interpretative lockup by embracing and building
upon Peirce's idea that any interpretation of a sign must consist in
the creation of a further sign, we can direct our attention towards
the generation of signs instead of towards the interpreation of
pre-existings signs or of signs declared to be signs by the very act
of their being interpreted. It is in this perspective that our
conception of elementary semiosis and the new concept of the semion
are proposed; the place the generative character of sign processes
and of sign worlds absolutely central. By this they seize the
possibility to no longer treat of structure and dynamics separately
and additively, to no longer think of a passive-object-like sign and
an active-subjekt-natured interpreter; instead, following the model
of matter- and energy-sciences, it becomes possible to conceive of
process and structure, of sign and meaning, as two aspects of one
single reality.
Thus a mode of treating of sign characters is proposed which does
not attempt to analize and systematize a selected and isolated range
of phenomena (because this leads to islands of separate
understanding). Instead we shall understand as being of semiosic
character whatever can mediate between two phenomena. The world is,
in fact, full of situations that cannot be dealt with in terms of
necessary determination of an effect by a single cause. In developing
a triadic condition-effect conception suitable for describing what
happens in evolutive systems we find that this not only accounts for
the evolutive process in general, but in addition as well for the
constitution of time.
Semiosis thus is thought of as a general notion of causation or
condition-effect-conception. Of sign-character are all entities which
emerge as a third from the encounter of two other entities (of
sign-character) and which can themselves enter such transactive
encounters and thus can generate new sign structure. The concept of
elementary semiosis presents this triadic relation in the
process-view, the concept of semion conceives of it as the logical
effect-connex implied in more or less enduring structures which can
preserve some effect potential over time and can allow for its
transportation over space. This generative or semion-semiotic thus
constitutes directed and ordinal temporality and it can explain the
present as the separation between the past and the future of a
system. In applying this idea on oscillating systems and entities in
general which run through intrinsic changes of state, we also have
found a semiotic constituent of biotic, psychic, and cultural time in
the triple sense of periodicity, of extensive duration, and of the
distinction between past, present and future.
Inhalt
Fussnoten
1.
Aufgrund eines Plenarvortrags am 7. Internationalen Kongress
der Deutschen Gesellschaft für Semiotik zum Thema Zeichen und
Zeit, in Tübingen am 6. Oktober 1993.
2.
Als semiosisch bezeichne ich, was Semiose als realen Prozess
betrifft; semiotisch heisse die Semiosen betreffende
Betrachtungsweise. Mit dem neuen Ausdruck Semion benenne ich
alle an Semiosen beteiligten und durch Semiose entstandenen, Semiosen
konstituierenden realen oder nominalenStrukturen; der Ausdruck ist
analog zum chemischen Ion und soll die dynamische
Relationsbereitschaft von zeichenhaften, dh bedeutungsvermittelnden
Strukturen akzentuieren.
3.
Das ist umso pikanter als Herder Kant's Schüler war und ab etwa
1764 dessen Transzendentalismus schon im Entstehen zu kritisieren
begann, übrigens mit ähnlichen Argumenten wie 100 Jahre
später Charles Peirce.
Inhalt
Literaturangaben
Boesch, Ernst E. (1993) The sound of the
violin. Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 52 (2)
70-81.
Lang, Alfred (1973) Der Umgang mit Dauer:
ein neues Modell der inneren Uhr. Pp. 587-596 in: Reinert, G. (Ed.)
Bericht über den 27. Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie in Kiel 197l. Göttingen, Hogrefe.
Lang, Alfred (1992a) Die Frage nach den
psychologischen Genesereihen -- Kurt Lewins grosse Herausforderung.
Pp. 39-68 in: Schönpflug, Wolfgang (Ed.) Kurt Lewin --
Person, Werk, Umfeld: historische Rekonstruktion und Interpretation
aus Anlass seines hundersten Geburtstages. Frankfurt a.M., Peter
Lang.
Lang, Alfred (1992b) Kultur als 'externe
Seele' -- eine semiotisch-ökologische Perspektive. Pp. 9-30 in:
Allesch, Christian; Billmann-Mahecha, Elfriede & Lang, Alfred
(Eds.) Psychologische Aspekte des kulturellen Wandels. Wien,
Verlag des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften
Österreichs.
Lang, Alfred (1993a) Non-Cartesian artefacts
in dwelling activities -- steps towards a semiotic ecology.
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 52 (2)
138-147.
Lang, Alfred (1993b) Eine Semiotik für
die Psychologie -- eine Psychologie für die Semiotik.
(Positionsreferat.) Pp. 664-673 in: Montada, Leo (Ed.) Bericht
über den 38. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie in Trier 1992. Vol. 2. Göttingen, Hogrefe.
Lang, Alfred (1993c) Zeichen nach innen,
Zeichen nach aussen -- eine semiotisch-ökologische Psychologie
als Kulturwissenschaft. Pp. 55-84 in: Rusterholz, Peter & Svilar,
Maja (Eds.) Welt der Zeichen -- Welt der Wirklichkeit. Bern,
Paul Haupt.
Lang, Alfred (1993d) Absolutes Gehör.
(auch in Originalversion von 20 S. verfügbar.) Pp. 558-565 in:
Bruhn, Herbert; Oerter, Rolf & Rösing, Helmut (Eds.)
Musikpsychologie -- ein Handbuch. Reinbek, Rowohlt. (2.
Auflage).
Lang, Alfred (1994 / im Druck) Menschen als
Schöpfer und Geschöpfe ihrer Welt der Kultur -- Herders
evolutiv-dialogisches Menschenbild. Pp xxx-xx in Wolfgang Pross &
Rupert Moser (Eds.) Herder und die Entstehung der modernen
Wissenschaften vom Menschen. Bern, Peter Lang.
Lang, Alfred (1997) Fluss und Zustand -
psychische, biotische, physische und soziale Uhren und ihre
psychologischen, biologischen, physikalischen und soziologischen
Modelle. Pp. 187-235 in: Peter Rusterholz & Rupert Moser (Eds.)
Zeit -- Zeitverständnis in Wissenschaft und Lebenswelt.
Bern, Peter Lang.
Lewin, Kurt (1922) Der Begriff der Genese
in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte: eine Untersuchung zur
vergleichenden Wissen schaftslehre. Berlin, Bornträger /
Springer. 45 Abb., 240 Pp. ((In Kurt-Lewin-Werkausgabe, Band 2, Pp.
47-318. Bern, Huber, 1983)).
Markwalder, Stefan (1993) Auf den Spuren des
Wohnens -- eine explorative Untersuchung zur Regulation der sozialen
Bezüge im Zweipersonenhaushalt. Diplomarbeit, Bern, Institut
für Psychologie der Universität. 116 Pp + Anhang.
Mayr, Ernst (1991) Eine neue Philosophie
der Biologie. (Erweiterte deutsche Ausgabe der Aufsatzsammlung
(1988) "Toward a new philosophy of biology".) München, Piper.
470 Pp.
Miles, Jack (1996) Gott - eine
Biographie. Aus dem Amerikanischen von Martin Pfeiffer.
München, Hanser.
Nisbett, Richard E. & Wilson, Timothy D.
(1977) Telling more than we can know: verbal reports on mental
processes. Psychological Review 84 231-259.
Peirce, Charles Sanders (1931ff.)
Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Charles
Hartshorne; Paul Weiss & Arthur W. Burks (Eds.) 8 vols. in 4
books Cambridge Mass., Harvard Univ. Press (Belknap Press). (2nd
printing 1960). Zitiert als CP Band.Abschnitt.
Peirce, Charles S. (1992) The essential
Peirce: selected philosophical writings. Houser, Nathan &
Kloesel, Christian (Eds.) vol. 1. Bloomington Ind., Indiana Univ.
Press. 399 Pp. Zitiert als EP Band:Seite.
Schönrich, Gerhard (1981) Kategorien
und transzendentale Argumentation: Kant und die Idee einer
transzendentalen Semiotik. Frankfurt a.M., Suhrkamp. 384 Pp.
Short, Thomas L. (1986) What they said in
Amsterdam: Peirce's semiotic today. Semiotica 60 (1/2)
103-128.
Ungeheuer, Gerold (1987) Vor-Urteile
über Sprechen, Mitteilen , Verstehen. Pp. 290-338 in: Juchem,
Johann G. (Ed.) Kommunikationstheoretische Schriften I.
Aachen, Alano / Rader Publ.
Top of Page