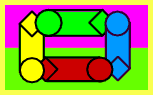Alfred Lang |
University of Bern, Switzerland
| 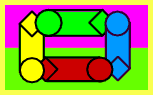 |
Journal Article 1979 |
Stellungnahme gegen die Reglementierung der Psychotherapie aus der Sicht eines allgemeinen Psychologen und eines besorgten Bürgers
Anhang: Gegen die Funktionalisierung des Existentiellen. Diskussionsbeitrag 1980-03
| 1979.01 @Ethic @SciPol |
27 / 32KB Last revised 98.10.31 |
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 1979, 38 (4), 290-299.
Bulletin der Schweizer Psychologen (BSP), 1980, 1 (6), 49-52. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Bei der Lektüre des Artikels von V. HOBI (1979) und den
Stellungnahmen seiner Amtskollegen in der klinischen Psychologie
fällt mir auf, daß einige grundlegende Aspekte des
Problems überhaupt nicht angesprochen werden. Sollte es sich
wirklich nur noch um gewissermaßen technische Fragen handeln:
Wer darf und wer nicht? Nur Psychologen, oder auch andere? Und die
Ärzte? Selbständig oder nur im Rahmen der Heilberufe? Wie
lange, von wem und auf welche Weise ausgebildet?
Nicht daß ich diese und solche Fragen für
geringfügig und leicht lösbar halte; aber ich möchte
doch die Professionalisierung und Reglementierung der Psychotherapie
noch einmal grundsätzlich in Frage stellen. Ich tue dies im
Bewußtsein, daß wenige mehr Solches hören wollen.
Allzu selbstverständlich sind uns vielleicht die Wege
etablierter Professionen geworden, zu weltweit haben die Staaten
Lizenzierungssysteme eingerichtet. Allzu groß ist vielleicht
auch der Druck einer großen Zahl von Berufsanwärtern
geworden, die öffentlich anerkannt und merkbar von sogenannten
Scharlatanen unterschieden sein möchten; zu stark wohl auch ein
politischer Druck nach Ausdehnung der Wohlfahrtsidee auch auf den
psychischen Bereich.
Dem entgegen möchte ich die These stellen, die
Psychotherapie sei in einer pluralistischen Gesellschaft nicht zu
reglementieren. Denn ich halte die damit notwendig verbundene
Professionalisierung eines für die menschliche Existenz
zentralen Lebensbereiches langfristig für schädlich: es
geht hier um grundsätzlich andere, eben existentielle,
und nicht bloß die üblicherweise und möglicherweise
mit einem gewissen Erfolg reglementierten funktionellen
Aspekte menschlichen Zusammenlebens.
Ich werde diese These von zwei Standpunkten her beleuchten, die
außerhalb des direkten Interessenkreises liegen; denn ich bin
weder an Psychotherapie interessiert, noch glaube ich, daß sich
rechtfertigen läßt, daß sich jemand zum Advokaten
eines immerhin selbst erfundenen «Konsumenten», aufschwingt
und dessen Schutz zu institutionalisieren versucht, obwohl er
gleichzeitig auch konträre [eigene] Interessen verfolgt. Einerseits werde
ich also aus der Sicht eines allgemeinen Psychologen argumentieren;
und hier vertrete ich dezidiert die Interessen einer jungen
Wissenschaft, wie ich sie verstehe. Andererseits werde ich als
überzeugter Verfechter einer liberalen Wertordnung einige
Gedanken zum Status professionalisierter Psychotherapie im Ganzen der
Gesellschaft außern.
Der Gesichtspunkt des Psychologen
Grundsätzlich bin ich der Meinung, die Psychologie werde, wie
alle Wissenschaften, mit dem Ziel der Lebensverbesserung betrieben:
der Menschen überhaupt - deshalb ist sie
«öffentlich» - und auch derjenigen, die sie betreiben.
Zwischen Grundlagenforschung und Anwendung in der Praxis dehnt sich
ein breites Feld wissenschaftlicher Tätigkeit aus: eine scharfe
Trennung ist unmöglich, ein intensiver Austausch für beide
Teile gleichermaßen lebenswichtig. Eine Stärkung der
Praxis, gewissermaßen die öffentliche Anerkennung eines
Anwendungszweiges in Form der Legalisierung der entsprechenden
Tätigkeiten müßte also auch dem
Grundlagenwissenschaftler willkommen sein. Ich schätze dennoch
die Nachteile einer solchen Reglementierung für das Ganze der
Psychologie größer ein als den Nutzen. Dies hat damit zu
tun, daß für mich vor allem die
«Wissenschaftlichkeit» oder die wissenschaftliche
Fundierung einer Tätigkeit eine Form der Rechtfertigung dieser
Tätigkeit gegenüber den direkt oder indirekt davon
Betroffenen darstellt. Von allen schlechten Formen der Rechtfertigung
ist sie immerhin die beste, weil sie den Betroffenen prinzipiell in
die Lage versetzt, die Begründung für das Tun und Lassen
lückenlos und zweifelsfrei nachzuvollziehen. (Ich kenne nur noch
eine bessere Form der Rechtfertigung, das ist die Liebe; sie eignet
sich aber nur als Rechtfertigung gegenüber direkt
«Betroffenen»; gegenüber den indirekt Betroffenen
wirkt sie häufig verheerend.)
Mit Wissenschaft meine ich hier nichts anderes als die
rationale Nachvollziehbarkeit eines möglichst umfassenden
Zusammenhangs des jeweils zur Frage stehenden Sachverhaltes bis
zurück zu einigen begrifflichen und methodischen Grundannahmen,
über die allerdings Konventionen zu treffen sind. Ein
wissenschaftliches Vorgehen kann insbesondere dazu dienen,
wahrscheinlicheEntwicklungen eines Sachzusammenhangs, so weit eben
die Kenntnisse im Augenblick reichen, offenzulegen und so das Treffen
von persönlichen oder politischen Entscheidungen über
anzustrebende Ziele und einzusetzende Mittel erleichtern.
Wenn man nun den Anspruch erhebt, die Tätigkeit in einem
Praxisfeld solle wissenschaftlich fundiert sein - und das tun die
Psychologen, wie an der «Wissenschaftlichkeit» ihrer
Ausbildung deutlich wird -, so ist es überflüssig, ja
schädlich, über diese nicht ganz schlechte Form der
Rechtfertigung eine zweite, deutlich schlechtere Form
aufzustülpen. Denn die Reglementierung eines Berufes läuft
doch praktisch darauf hinaus, daß deklariert wird, derjenige,
der zum Beruf zugelassen wird, übe diese Tätigkeit a priori
korrekt und nutzbringend aus. Mit andern Worten, diese zweite Form
der Rechtfertigung enthebt den Berufsmann gewissermassen der
Verpflichtung, sich um die erste Form der Rechtfertigung weiterhin
intensiv zu kümmern. Natürlich muß das nicht
notwendig so sein, aber praktisch ist es naheliegend infolge der
seltsamen Paradoxie, daß man einen Teil der ersten
Rechtfertigung zum Kriterium der zweiten macht. Zur Tätigkeit
der Psychotherapie soll ja besonders auch nach der Meinung der
Dozenten für klinische Psychologie nur zugelassen werden, wer
sich während einer gewissen Zeit mit wissenschaftlicher
Psychologie beschäftigt hat.
Die Reglementierung der Psychotherapie impliziert also eigentlich
eine Bankrotterklärung ihrer Wissenschaftlichkeit.
Das ist freilich nicht, was die Professoren der klinischen
Psychologie anstreben; sie haben ja explizit den wissenschaftlichen
Charakter der Ausbildung der Psychotherapeuten sowohl in der
psychologischen Grundausbildung wie in der psychotherapeutischen
Spezialausbildung auf ihre Fahnen geschrieben. Entweder ist also
meine obige Argumentation falsch, oder aber die Kollegen haben das
Bedürfnis, für eine bestimmte (d. h. jeweils
«ihre») Wissenschaftlichkeit einen gesetzlich
geschützten «Freiraum» zu errichten. Das geht
natürlich auf Kosten irgendeiner andern, für weniger gut
erklärten «Wissenschaftlichkeit». Ich habe keinen
Anlaß, den Kollegen irgendwelche unlauteren Motive
zuzuschreiben. Bis zum Beweis des Gegenteils möchte ich
gutgemeinte Absicht aber auch jedem andern zubilligen, der sich
für einen «Psychologen» hält. Ich weiß
wohl, daß Auseinandersetzungen zwischen wissenschaftlichen
«Traditionen» nie frei von «Politik» sein
können (FEYERABEND, 1975); aber es sollte nicht nötig sein,
gute Argumente mit Macht zu stützen.
Nun haben wir uns in unserer Gesellschaft daran gewöhnt,
Probleme dieser Art auf eine weniger unbedingte Weise anzugehen. Ich
will denn auch versuchen, ganz konkret mir vorzustellen, was man als
praktische Folgen einer solchen Reglementierung zu erwarten
hat. Ich halte die Vorzugsbehandlung eines Anwendungsfeldes
einer auf sehr breitfächerige Anwendung angelegten Wissenschaft
für nachteilig, weil sie diese Wissenschaft in Forschung und
Lehre dazu nötigt, diesem einen Sektor eine Sonderbehandlung
einzuräumen. Es wird schwieriger werden in einer Zeit knapper
Ressourcen, für andere, nicht minder wichtige Sektoren
Forschungsgelder zu erhalten. Es wird noch schwieriger werden als es
ohnehin jetzt schon ist, im öffentlichen Bewußtsein die
Psychologie als eine von Krankheit und Medizin zunächst und zur
Hauptsache separate Unternehmung darzustellen. Es wird schwieriger
werden, die Psychologie als eine Wissenschaft zu betreiben und sie
vor Verwechslung mit einer problematischen Technologie zu bewahren.
Es wird schwieriger werden als es jetzt schon ist, freimutig die
Ignoranz in so vielen Dingen des Psychischen zu bekennen: vom
offiziell anerkannten Fachmann erwartet man Lösungen, nicht
Warnungen.
Vor allem aber erwarte ich nachteilige Folgen im Bereich der
Ausbildung der Psychologen. Man wird mir triftig entgegenhalten,
daß es im Gegenteil leichter sein wird, für eine an den
Universitäten anzusiedelnde Psychotherapeuten-Ausbildung neue
Stellen bewilligt zu erhalten; daß so erst überhaupt daran
gedacht werden kann, die nötigen Einrichtungen für eine
verantwortbare Praxis-Ausbildung zu schaffen; daß endlich eine
Chance entstehe, das jetzt so extreme Mißverhältnis in den
Studenten-Dozenten-Quotienten zwischen Medizin und Psychologie zu
korrigieren; daß auch für die Grundlagenausbildung in den
allgemeinpsychologischen Zweigen von der Wahrnehmungspsychologie bis
zur Entwicklungspsychologie einige Brosamen abfallen werden. Das
alles ist zunächst nicht auszuschließen, wenngleich
keineswegs gesichert. Aber wir müssen einen hohen Preis
dafür bezahlen. Für all diese in einem hybriden Zeitalter
so erstrebenswerten Dinge müssen wir nämlich einen Teil
unserer wissenschaftlichen Freiheit hergeben. Wenn wir jetzt
freiwillig eine Forschung und Ausbildung betreiben, von der man
erwarten kann, daß sie auf lange Frist zur Verbesserung der
menschlichen Situation beiträgt, so werden wir im Hinblick auf
die reglementierte Berufszulassung und im Rahmen einer
reglementierten Berufsausbildung genau jene Dinge tun und lassen
müssen, die diese Reglemente fordern - nicht nur durch
Vorschriften, sondern auch durch Sachzwänge, die ja viel
wirksamer sind. Man denke etwa an die Auswirkungen von
Staatsexamensordnungen auf die Studienpläne und erst recht auf
das ganze Studienverhalten. Artikel 33 der Bundesverfassung sieht
vor, daß die Kantone «die Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten von einem Ausweis der Befähigung
abhängig» machen können; solche Ausweise müssen
für das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft gültig sein;
dafür hat die Bundesgesetzgebung zu sorgen. Im Bereich des sog.
Gesundheitswesens hat der Gesetzgeber in der Tat eine mächtige
Zunft geschaffen. Brauchen wir wirklich etwas Analoges im Bereich
unserer seelisch-geistigen Existenz?
Die Reglementierung der Psychotherapie und ihre zwangsweise
Koppelung an die Psychologie bedeutet mithin den Anfang der
Reglementierung der Psychologie; dies scheint mir unerwünscht
und nachteilig sowohl für die Psychologie wie für die
Psychotherapie.
Der Gesichtspunkt des Bürgers
Nun ist aber die Psychotherapie weder eine Sache der Psychologen
noch der Mediziner allein. Betroffen ist auch jeder Bürger. Er
hat es nicht leicht - schon gar nicht als Patient - in einer Sache,
wo die Fachleute über einen solchen Wissens- und
Prestigevorsprung verfügen und dennoch so unterschiedliche Meinungen vertreten. Ich will daher versuchen, vom
Standpunkt eines neutralen Betroffenen aus zu argurnentieren.
Die erste Frage ist wohl, wie sichergestellt wird, daß
jedermann im Falle entsprechender Bedürftigkeit eine ihm selber
und seiner Umwelt in jeder Hinsicht gerecht werdende und effektive
Dienstleistung erhalten kann. Und die zweite, nicht minder wichtige,
von den Fachleuten, die sich zum Advokaten des Klienten
erklären, in der Regel vergessene Frage: Wie wirkt sich so etwas
auf die Gesellschaft insgesamt aus?
Psychotherapie dient der Behebung von psychischen Störungen,
der Herstellung oder Wiederherstellung psychischer Integrität
(was immer das sein mag) von Individuen und Gruppen. Sie ist also
eine Art «Produktionsmittel» für private und auch
öffentliche Dienstleistungen (öffentliche, weil indirekt
auch andere betroffen sind, wenn dem einen in seinem Lebensplan
geholfen oder nicht geholfen wird).
Damit stellt sich die Frage, wer dieses
«Produktionsmittel» besitzen oder kontrollieren soll, wer
zur Verminderung von Störungen und zur Verbesserung psychischer
Integrität investieren und wer am direkten und wer am
indirekten Nutzen teilhaben soll. In unserer Gesellschaft ist eine
private, eine staatliche und eine gemischte .Bewirtschaftung.
denkbar, selbstverständlich immer im Rahmen des Rechtsstaates.
Faktisch haben wir in der Schweiz eine gemischte Ordnung, insofern
der Staat für einen Teil der Ausbildung sorgt und eine Reihe von
psychotherapeutischen Diensten führt, teils im Rahmen des sog.
Gesundheitswesens, teils im Rahmen des Erziehungswesens, daneben aber
jedermann psychotherapieartige Dienstleistungen anbieten kann,
legalerweise freilich nicht zu Heilzwecken.
Ich halte diese Ordnung für angemessen und meine, daß
sie nicht zugunsten des Staates verändert werden soll. Denn ein
öffentliches Ziel von Psychotherapie kann nur die
Normalisierung, die Anpassung von Abweichendem an das allgemein
Akzeptierte sein; im Geiste pluralistischer Toleranz ist gewiß
eine breite Duldung und sogar Förderung von Alternativen
möglich, welche allerdings in Notzeiten leicht gefährdet
sein können. Ich glaube daher, daß Psychotherapie
grundsätzlich nicht als eine öffentliche Aufgabe betrachtet
und vollständig dem Staat aufgetragen werden soll; denn sie ist
ein Instrument, das dazu eingesetzt werden kann, das Recht des
Menschen auf Abweichung zu beschneiden. Gewiß ist ein Anrecht
auf angemessene medizinische und psychotherapeutische Versorgung eine
großartige Errungenschaft menschlicher Solidarität, sofern
es durch das ebenso wichtige Recht auf sein eigenes Leben und seinen
eigenen Tod relativiert wird.
Die Ausgangsfrage nach der Sicherstellung einer adäquaten
Versorgung reduziert sich damit auf die Frage nach der Aufsicht
und Kontrolle. Wiederum ist eine staatliche oder eine private
Einrichtung denkbar.
Die staatliche Aufsicht ist das in der gegenwärtigen
Diskussion vorherrschende, in den Basler Kantonen realisiert und von
den Kollegen einmütig begrüßte Modell der
Reglementierung der Berufszulassung. In jeder denkbaren Variante der
Staatsaufsicht ist man auf die Fachleute angewiesen, welche als
Fachkommission oder -kammer die Zulassungskriterien aufstellen und
die Grenzentscheide treffen. Mit andern Worten: die zu
Beaufsichtigenden beaufsichtigen im Prinzip sich selber.
Natürlich ist es leicht, in einem formalen Verfahren Schafe und
Böcke auszusondern. Ob aber nicht manche zu Schafen
erklärte dann Böcke und nicht manche Böcke eigentlich
Schafe sind, ist nicht auszuschließen. Das mittelalterliche
Zunftdenken lebt fröhlich weiter. Mein Gerechtigkeitsgefühl
sträubt sich dagegen.
Aber wie unterscheidet man wirklich Fachleute von
Scharlatanen? Doch wohl nur an ihrem Effekt, an ihrem Erfolg;
vielleicht an einer geschätzten Wahrscheinlichkeit ihres
Erfolges. Und da stellt sich die Frage, ob die Psychotherapie eine
inserumentelle Methode oder eine an die Person des Therapeuten
gebundene Sache ist. Eine instrumentelle Methode kann man als solche
spezifizieren; sie kann von irgendjemand nach geeigneter
Einführung übernommen und mit gleichem Effekt angewendet
werden. Für ein Instrument kann man Erfolgswahrscheinlichkeiten
abschätzen. Ziemlich einmütig sagen die Vertreter der
psychotherapeutischen Richtungen, daß Ausbildung und Erfahrung
essentiell, die Person des Therapeuten freilich auch wichtig sei. Die
Erfolgsforschung spricht eine andere Sprache: es ist m. W. bisher
nicht gelungen zu beweisen, daß langgeschulte und langerfahrene
Psychotherapeuten bessere Erfolge erzielen als
Ausbildungsanfänger und Laien. Die von DURLAK ( 1979)
zugammegestellten 42 Vergleichsuntersuchungen beweisen eher das
Gegenteil. Nach allen bisherigen Evaluationsergebnissen der
Psychotherapie-Forschung kann man wohl sagen, daß die
verschiedenen Formen der Psychotherapie insgesamt besser sind als
nichts; d.h. im Durchschnitt ergibt sich eine Wirkung in der
erwünschten Richtung (SMITH und GLASS, 1977). Aber leider wissen
wir gar nicht, woran das liegt, welcher aufzeigbare Zusammenhang
genau für die Wirkung verantwortlich ist. Mit wenigen Ausnahmen
(wie VT bei gewissen Phobien) hat die Psychotherapie gemäß
heutigem Kenntnisstand den Status eines Placebos.
Nach immerhin einigen Jahrzehnten Psychotherapie-Forschung wissen
wir nicht, worauf es ankommt. Man kann diese Tatsache pessimistisch
beurteilen oder auf die Erfolge künftiger Untersuchungen hoffen;
aber nachdenklich stimmen sollte sie jeden gewissenhaften Beobachter.
Wenn die einen die andern Scharlatane nennen, dann muß man
immer nach Belegen fragen. Meinen sie damit moralische oder fachliche
Inkompetenz, und woran messen sie beides? Solange ich sehen
muß, daß man solche Fragen als Machtfragen und nicht als
Sachfragen ansieht, ist meine Schlußfolgerung jedenfalls,
daß es nicht einen, sondern viele und möglichst
verschiedene Zugangswege zu helfenden Tätigkeiten im Sinne von
Psychotherapie geben muß. Niemand sollte ein Monopol
beanspruchen.
Und was wissen wir über die Nebenwirkungen von
Psychotherapie? So gut wie nichts. Es ist nicht
auszuschließen, daß spätere Generationen die
Psychotherapie ähnlich beurteilen werden wie wir heute manche
früher hochgejubelte zivilisatorische Errungenschaften der
Fortschrittgläubigkeit: als eine Form der Umweltverschmutzung.
Die Hoffnungen, die manche heute an Psychotherapie knüpfen,
stehen in seltsamem Widerspruch zur Technologiefeindlichkeit
derselben Kreise.
«Die Bewußtseinsverwüstung unter den Menschen ist
größer als die Verwüstung der Natur, die sie
anrichten», schreibt der Freiburger Philosoph FRANZ VONESSEN
(1978), und er meint, eine nur biologisch orientierte Ökologie
stehe auf verlorenem Posten. Ich schäme mich für den nicht
unbeträchtlichen Teil, den «Psychologen» zu dieser
Verwüstung beigetragen haben
Die Psychotherapie heute ist eine stark personalisierte
Angelegenheit zwischen Klient und Psychotherapeut. Hier gibt es keine
allgemeingültigen Erfolgswahrscheinlichkeiten abzuschätzen.
Und damit ist auch kein Platz für eine öffentliche
Kontrolle. Schützt das Reglement den einen Klienten vor einem
unfähigen Therapeuten, so führt es den andern in ein Netz
von Hoffnungen und Abhängigkeiten. Ich sehe keine
Möglichkeit, eine verbindliche Bilanz aufzustellen, welche den
Eingriff einer staatlichen Instanz rechtfertigen könnte. Die
Fragen, deren Antworten eine Aufsichtsbehörde kennen
müßte, um ihre Entscheidungen der Willkür zu
entziehen, lauten:
- Was für Verbesserungen? werden durch - welche Art Verfahren?
- an was für Patienten?
- durch was für Therapeuten?
- unter welchen Bedingungen hervorgebracht? (PARLOFF, 1979)
Die Frage so stellen, heißt aber fürchten, daß
jeder Versuch ihrer gründlichen Beantwortung den total
verwalteten Menschen voraussetzen muß. Beizufügen
wäre noch die Frage:
- was für Nebeneffekten?
Wenn aber Psychotherapie nicht eine instrumentelle Methode ist,
dann läßt sich nicht verantworten, sie zum
Kristallisationspunkt einer Profession zu machen. Und wenn sie als eine instrumentelle, wissenschaflicht zertifizierte Methode wäre, würde das heissen, dass man also mit Menschen umgeht wie mit Verfahren oder Maschinen. Nach dem Stand der
Dinge kann ja die Aufsichtsbehörde dem Klienten nicht
garantieren, daß er vom zugelassenen Psychotherapeuten in einer
dem Problem des Klienten und seinem Umfeld angemessenen Weise mit
Erfolgsaussicht behandelt wird. Nur das könnte doch der Sinn von
Aufsicht sein. Man zertifiziert schliesslich Brücken, damit man sich risikolos darauf bewegen kann. Die Analogie zu Menschenbetreuung ist nicht gegebeben.
Von einem Zulassungsverfahren müßte man - schon aus
Gründen der Rechtsgleicheit - verlangen, daß es ein
gewisses (und eigentlich sehr hohes!) Ausmaß an Gültigkeit
im Sinne der Gütekriterien für Selektionstests aufweist.
Die magere Evidenz über diesen Punkt ist wenig ermutigend
(KOOCHER, 1979). Der Verdacht liegt nahe, daß eine
Reglementierung zwar im Namen des Schutzes des Publikums
eingeführt wird, in Wirklichkeit aber dazu dient, das Fehlen
einer öffentlichen Rechenschaftsablage zu kaschieren (GROSS,
1978).
Es ist bedenklich, unter diesen Umständen von
Psychotherapeuten den Nachweis von Kompetenz anhand von
Ausbildungskriterien zu verlangen. Nach meinem Rechtsempfinden ist in
analogen Fällen die Beweislast umgekehrt. Wir kennen zwei Arten
von Einschränkungen in Tätigkeiten, durch die ein
öffentliches Interesse in gravierendem Ausmaß tangiert
ist. Wenn jemand durch seine Tätigkeit anderen Schaden
zufügt bzw. den gesetzten rechtlichen Rahmen sprengt, wird man
ihn a posteriori verfolgen und die Wiederholung zu verhindern und die
Öffentlichkeit vor ihm zu schützen Vffsuchen. Nur wenn es
sich um Tätigkeiten handelt, die geeignet sind, direkt
öffentliche Interessen zu verletzen, auferlegen wir a priori
eine Einschränkung. Der Psychotherapeut gefährdet
allenfalls den ihn freiwillig aufsuchenden Klienten. Besser als die
Regelung der Zulassung zur Tätigkeit wäre also das
Aufstellen von Regeln über die Ausübung der Psychotherapie.
Ansätze dazu gibt es in den Ethischen Richtlinien der
Psychologenverbände (z. B. SGP, 1975). Bei ihrer Verletzung
müßten allerdings Sanktionen getroffen werden können.
Der Mißbrauch von Psychotherapie muß a posteriori
vermindert werden.
Nach diesen prinzipiellen Feststellungen sind wieder einige
pragmatische Überlegungen angezeigt.
Ich glaube, daß wir in dieser Zeit drei Wege zur
Verbesserung der psychischen Situation vieler Menschen
benötigen. In akuter Not müssen sie sich an eine Instanz
wenden können, von der Hilfe in aller Wahrscheinlichkeit
erwartet werden kann. Aber vergessen wir darob nicht den Normalfall
der Irrungen und Wirrungen der Lebenswegfindung, der mit Hilfe der
Beziehungspersonen des Alltags bewältigt werden sollte.
Für alle jene Fälle, wo die Alltagshilfen nicht
ausreichen - und wir sollten sehr Sorge tragen, daß diese
Fälle nicht überhandnehmen - ist es angezeigt,
psychotherapeutische Dienstleistungen der verschiedensten Art
einzurichten. Diese brauchen keineswegs alle auf die heute
vorherrschenden Formen wissenschaftlicher Psychologie ausgerichtet zu
sein. Was der Klient dann in erster Linie braucht, ist nicht eine
Generalgarantie, sondern eine Orientierungshilfe: Information und
Beistand, welche dazu beitragen, daß er die für seine
Problemsituation optimale beraterische oder therapeutische Hilfe
finden kann.
1. Es gibt Problemsituationen und -zustände, für welche
psychotherapeutische Hilfe im engeren Sinn angezeigt ist, und wegen
der besonderen Natur solcher Zustände ist eine gewisse
Schutzaufsicht zu akzeptieren. Aber gerade auch wegen der heiklen
Natur solcher Nöte ist die Kontrolle der helfenden Instanz mit
allergrößter Sorgfalt im Hinblick auf die persönliche
Würde der Hilfesuchenden zu gestalten.
Es wird schwer zu vermeiden sein, solche Nöte anders denn als
«Krankheiten» zu verstehen, wenn dies der Hilfesuchende so
«wünscht» bzw. von den damit verbundenen Konsequenzen
Vorteile davonträgt. Es ist ein offenes Geheimnis, daß
sich von einer solchen Auffassung auch manche Psychotherapeuten
Vorteile versprechen. Mir scheint allerdings, daß die
traditionelle Arztrolle nicht genügend Gewähr bietet
für eine person-, problem- und umständegerechte Betreuung
solcher Patienten. Das gilt natürlich ebenso, wenn diese Rolle
auf einen weiteren, nichtmedizinischen Personenkreis ausgedehnt wird.
Im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung gibt es jedoch, so weit ich
sehe, kein hartes Argument, mit dem verhütet werden könnte,
die professionalisierte Psychotherapie von Kranken anders denn
als Bestandteil des Gesundheitswesens zu verstehen. Allerdings bin
ich überzeugt, daß es nicht in erster Linie der Mensch in
der Krise ist, der dazu neigt, seine Probleme unter dem Aspekt von
Krankheit zu verstehen, sondern daß das Angebot der
«Medizin» ihn dazu verleitet. (Ich formuliere notgedrungen
pauschal; natürlich wäre zu differenzieren, um was für
Nöte es geht.)
Deshalb plädiere ich dafür, so wenig wie möglich
von der Psychotherapie zu professionalisieren und irgendeiner
medizinischen Reglementierung zu unterstellen.
2. Wer leidet, ist freilich nicht notwendig auch krank.
Genügt denn für denjenigen, der seine Not nicht als
Krankheit verstehen will, nicht die private Aufsicht über
die Psychotherapie? Wer bei einem Therapeuten Hilfe erfahren oder
nicht erfahren hat, kann diese Information den andern zur
Verfügung stellen. Spezialisten mit den verschiedensten
Vorgehensweisen können entstehen und vergehen, wie es eben ihre
tatsächlichen Erfolge oder Mißerfolge rechtfertigen.
Für staatliche oder andere öffentliche
Dienstleistungsstellen sind Anstellungskriterien ausreichend, die auf
die wissenschaftlich fundierte Ausbildung abstellen (und der
tatsächliche Erfolg der Therapeuten sollte auch eine Rolle
spielen). Die Psychotherapeutenverbände - und es muß nicht
ein Einheitsverband sein - könnten die anspruchsvolle Aufgabe
wahrnehmen, dafür zu sorgen, daß ihre Mitglieder
öffentlich dargelegte berufsethische Grundsätze einhalten.
Auch sie können nicht garantieren, daß der Psychotherapeut
hilft; sie können aber - und das ist nicht wenig - dafür
sorgen, daß der Psychotherapeut ein menschlicher Partner des
Patienten ist. Und sie können über seine Ausbildung und
über seine Spezialisierung informieren. Das ist die wirksamste
Kontrolle, die ich mir vorstellen kann.
3. Ich sehe aber als Hauptaufgabe für die Psychologie,
auf eine Welt hinzuarbeiten, in der man zusammen mit seinen
Nächsten leben und sich im Regelfall zurechtfinden kann, ohne
daß man sich einem fremden Experten für das eigene Selbst
überantworten muß.
Ich danke einer großen Zahl von Fachkollegen, die im Lauf
der Jahre meiner oft harten Kritik zugehört haben: ohne ihren
Widerspruch und ohne ihr Verständnis wäre die vorliegende
Stellungnahme nicht möglich gewesen.
Literatur
DURLAK, J. A.: Comparative effectiveness of paraprofessional and
professional helpers. Psychological Bulletin 86 (1) 1979,
80--92.
FEYERABEND, P.: Against rnethod. 1975. Deutsch u. d. T.:
Wider den Methodenzwang: Skizze einer anarchistischen
Erkenntnistheorie. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1976.
GROSS, S. J.: The myth of professional licensing. American
Psychologist 33 1978, 1009--1016.
HOBI, V.: Einige grundsätzliche Überlegungen zur
Reglementierung selbständiger psychotherapeutischer
Tätigkeit durch Nicht-Ärzte. Schweiz. Z. Psychologie
38(2) 1979, 97--109.
KOOCHER, G. P.: Credentialing in psychology: close encounters with
competence? American Psychologist 34(8) 1979, 696-702.
PARLOFF, M. B.: Can psychotherapy research guide the
policymakers? American Psychologist 34(4) 1979, 296-306.
SGP: Ethische Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft
für Psychologie. Schweiz. Zeitschrift für Psychologie
34 1975, 362-366.
SMITH, M. L. & G. V. GLASS: Meta-analysis of psychotherapy
outcome studies. American Psychologist 32 1977, 752-760.
VONESSEN, F.: Die Herrschaft des Leviathan. Stuttgart,
Klett-Cotta, 1978.
Anhang:
Alfred Lang
University of Bern, Switzerland
Journal Article 1980
Gegen die Funktionalisierung des Existentiellen
Diskussionsbeitrag
1980-03
@Ethic @SciPol
10 / 21KB Last revised 98.11.01
Bulletin der Schweizer Psychologen (BSP), 1980, 1 (6), 49-52.
In einigen Reaktionen (z.B. HOBI 1979) auf meine Position bezüglich der Psychotherapie-Reglementierung (LANG 1979) glaube ich Missverständnisse zu entdecken, zu deren Klärung die nachfolgenden Bemerkungen in aller Kürze vielleicht dienen können. Sowohl die anthropologischen Voraussetzungen meiner Position wie auch meine wissenschaftstheoretische Orientierung sind in diesem Aufsatz aus naheliegenden Gründen nicht expliziert worden; dies ist auch hier nicht möglich; doch können einige Hinweise zum besseren Verstandnis beitragen.
Ich bin in meinem Beitrag (1979), dessen in weiten Kreisen erstaunlich positive Aufnahme ich eigentlich nicht erwartet hatte, von der Unterscheidung zwischen funktionalen und existentiellen Lebensbereichen ausgegangen. Funktional ist, wofür bei gegebenen Voraussetzungen auf explizierbare Ziele hin spezifizierbare Mittel eingesetzt und das Erreichen jener Ziele mit diesen Mitteln rational überprüft werden kann. Rational heisst dabei einfach: grundsätzlich vernünftig nachvollziehbar; wer sich einer solchen funktionaler Mittel-Ziel-Relation bedient, ist nicht auf Glauben angewiesen, sondern kann mit den Mitteln des Verstandes einigermassen lückenlose Verbindungsglieder zwischen den Vorbedingungen, den einsetzbaren Mitteln oder vermittelnden 'Mechanismen' und den angestrebten Zielen oder zu vermeidenden Zuständen aufzuzeigen.
Wissenschaft ist eine sozial besonders wichtige Form solcher Rationalität, weil sie sich bemüht, über die individuelle Rationalität hinaus eine intersubjektive (manchmal 'objektiv' genannte) Gültigkeit funktionaler Zusammenhänge aufzuzeigen. Angewandte Wissenschaft ist darauf angelegt, alles, was ihr unter die Finger kommt, zu funktionalisieren; es gibt für sie keine andere mögliche Vorgehensweise. Natürlich liegt darin, hat man einmal wie in unserer Kultur mit dieser Weise der Welt- und Lebensbewältigung angefangen, sowohl eine grosse Chance wie eine grosse Gefahr. Obwohl mit wissenschaftlich fundierten Problemlösungen viel Angenehmes geschaffen wird, zeigt die Erfahrung, dass immer zugleich neue Probleme entstehen; das sind die Nebenwirkungen oder die 'Umweltverschmutzung', weil Funktionalisierung immer nur von abgegrenzten Teilbereichen, nie des Ganzen möglich ist. Es ist also unbedingt notwendig, der Wissenschaft und ihrer immanenten Ausdehnungsdynamik Schranken aufzustellen. Ich versuche, solche Schranken in der individuellen Existenz des Menschen und in der autonomen Existenz natürlicher Gruppen zu sehen und zu fördern. Ich komme darauf zurück; man erwarte allerdings nicht, dass ich sagen kann. was das ist: das Existentielle.
Die Psychotherapie oder die Psychologie überhaupt als einen wissenschaft1ich fundierten Beruf auszuüben bedeutet also notwendig eine (wenigstens teilweise) Funktionaliserung der betroffenen Lebensbereiche. Man kann nun die anderen Menschen wie irgendeinen Objektbereich behandeln und eine funktionelle 'Technologie' in verschiedenen Formen auf ihn anwenden. Ich glaube, man muss dies wirklich ein Stück weit tun, einfach weil uns sonst die Funktionalisierung der anderen Lebensbereiche und ihrer Folgen (der Technik, der Arbeitsteilung, der Bevölkerungszunahme, der Urbanisierung, des Verkehrs usf.) über den Kopf wächst. Psycho-soziale Technologie ist dann eine Art Gegen-Technologie oder einfach ein weiteres Glied in der Kette der Technologien, deren spätere immer auch Versuche sind, die von den früheren angerichteten Schäden zu beheben. Psychologen müssen daran interessiert sein, dass ihre Technologie in einer ähnlichen Weise wie die anderen Technologien öffentliche Anerkennung findet. Der Ruf nach Psychotherapeuten-Reglementen und anderen Regelungen ist daher begreiflich. Unter den Psychologen insgesamt bestehen aber immerhin Interessengegensätze, die man nicht übersehen sollte. Ich versuche, die hauptsächlichen Positionen aufzuzeigen:
• Erstens gibt es die Psychologen, die ihre Tätigkeit nicht als einen Sozialberuf aufgefasst wissen möchten. Ueber sie ist beispielweise im Tessiner Regolamento dennoch verfügt worden. In anderen wichtigen Verordnungen (Basler Verordnung) und Entwürfen (Kanton Zürich und Sanitätsdirektorenkonferenz) werden sie nicht erwähnt; manche Reglementierungs-Promotoren möchten sie jedoch auf dem Wege der Interpretation mit einschliessen. Es ist zu hoffen. dass in dieser Sache das Bundesgericht ein klares 'Wort' spricht, d.h. verneint, dass für eine Reglementierung aller Psychologenberufe in der Medizinalgesetzgebung eine ausreichende Grundlage besteht (vgl. WINTER 1979). Im längerfristigen Interesse auch der helfenden Psychologen sollte man unbedingt der Psychologie einen weiterreichenden Horizont zugestehen.
• Zweitens gibt es unter den Psychologen, welche ihr Wissen und Können unmittelbar zum Besten der leidenden Mitmenschen einsetzen wollen, speziell den Psychotherapeuten, zwei gegensätzliehe Vorstellungen über die dazu geeigneten Mittel: die einen wollen die traditionelle Arztrolle auf den Psychotherapeuten übertragen (dies wird in der Basler Verordnung, im Tessiner Regolamento sowie in den Entwürfen der Zürcher Gesundheitsdirektion und der Sanitätsdirektorenkonferenz formuliert); die andern möchten neben, den kurativen vermehrt präventive und rehabilitative Konzeptionen verwirklichen und längerfristige Entwicklungen zur Verbesserung der psycho-sozialen Situation der Bevölkerung einleiten (dies wird durch die erwähnten Verordnungen und Entwürfe zwar nicht verhindert, aber doch wohl erschwert).
• Drittens gibt es Psychologen, die daran zweifeln, dass es sich bei den gegenwärtig verbreiteten psychotherapeutischen Verfahren um eine wissenschaftlich fundierte Technologie mit nachgewiesener Wirksamkeit handelt. Einige von ihnen setzen auf die weitere Entwicklung; andere können etwa den Optimismus von PERREZ & DIAS (1980) grundsätzlich nicht teilen. Sie setzen sich daher entweder für ein möglichst langes Offenlassen der Entwicklungen auf diesem Felde ein oder sie geben zu bedenken, dass solche technologischen Mittel prinzipiell nur in begrenztem Ausmass und mit aller Vorsicht bezüglich Nebenwirkungen einzusetzen seien. Sie warnen vor weiterer Funktionalisierung des Existentiellen.
Nun werden sich freilich die meisten tiefenpsychologisch orientierten,. die 'humanistischen' und andere Psychotherapeuten gegen eine Bezeichnung ihres Tuns als 'Technologie' wehren. Ich möchte hier nicht um eine Terminologie streiten, aber immerhin die Frage aufwerfen, ob eben nicht mit der Charakterisierung des psychotherapeutischen Tuns als 'wissenschaftlich' und mit der Forderung, dieses Tun beruflich nur bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung ausüben zu dürfen, genau jene Funktionalität angesprochen ist, auf die ich oben hingewiesen habe.
Auch wenn man betont, dass Psychotherapeuten versuchen, in ihren Klienten nicht nur ein zu behandelndes 'Objekt', sondern auch ein handlungsfähiges 'Subjekt' (in welchem Stadium einer "Krankheit'?) zu sehen, wird man akzeptieren müssen, dass hier ein fundamentales Dilemma besteht: je mehr auf Wissen und Können abgestellt wird, desto geringer ist der Platz für das Existentielle der betroffenen Person oder Gruppe.
Aufgrund dieser Überlegungen müsste man erwarten, dass die Vertreter verschiedener Therapie-Richtungen umso stärker für Zulassungs- und Kontrollverordnungen eintreten, je mehr sie die funktionalen Aspekte ihres Tuns für wichtig halten. Das ist in einem gewissen Ausmass der Fall (z.B. bei Verhaltenstherapeuten auf der einen, bei 'eigentlichen' Psychotherapeuten auf der anderen Seite). Insoweit diese Korrelation nicht stimmt, wäre denkbar, dass andere als sachliche Motive die Einstellungen bestimnen könnten.
Man wird mir auch entgegnen, dass die verschiedenen Psychotherapeuten-'Schulen' ja gerade mit ihren anthropologischen Ansprüchen dem Existentiellen im Menschen gerecht werden wollen. Die Intention sehe ich wohl und ich schätze sie nicht gering; indessen stört mich, dass zusammen mit den funktionalen Aspekten der Psychotherapie gewissermassen die Menschenbilder mitreglementiert werden müssten. Neuere Wissenschaftstheorie macht offensichtlich, dass wissenschaftliche 'Traditionen' niemals eine ihnen immanente Rechtfertigung haben können (GOEDEL; FEYERABEND 1979). Menschenbilder bedürfen eben so sehr oder mehr noch als andere Projekte des Menschen des harten Windes offener Konkurrenz, nicht staatlich geregelter Schutzzonen.
Ich wende mich aus zwei Gründen gegen die professionalisierte und gross angelegte Funktionalisierung des Existentiellen: erstens ist das funktionale Verständnis psycho-sozialer Prozesse viel zu partiell und auch (noch?) zu wenig gut; und zweitens bewegt mich die Sorge um das Existentielle.
Literaturangaben
FEYERABEND, P.: Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1979.
HOBI, V.: Antwort auf die Stellungnahmen zur Reglementierung der Psychotherapie. Schweiz. Zeitschrift für Psychologie 38 (4) 1979 337-349.
LANG, A.: Stellungnahme gegen die Reglementierung der Psychotherapie aus der Sicht eines allgemeinen Psychologen und eines besorgten Bürgers. Schweiz. Zeitschrift für Psychologie 38 (4) 1979 290-299.
PERREZ, M. & DIAS, B.: La psychothérapie est-elle efficace? Bulletin Suisse des Psychologues, Mai 1980, 9-14.
WINTER, E.: Staatsrechtliche Beschwerde in Sachen Tessiner Psychologen- und Psychotherapeuten-Reglement: Sachlage und Begründung. Schweiz. Zeitschrift für Psychologie 38 (4) 1979 322-336.